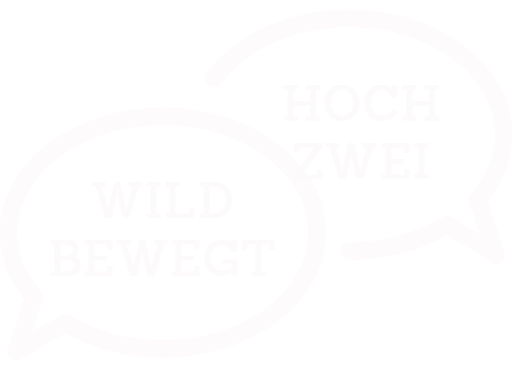M: Gestern habe ich vor dem Hundespaziergang aus der Winterschublade Handschuhe und Mütze geholt, eine Aktion, die jedes Jahr die trübe und kalte Jahreszeit einläutet. Ein bisschen trübe war dabei auch meine Stimmung, denn die Wochen vor dem Jahreswechsel finde ich die am schwersten erträglichen. Den „richtigen“ Winter mag ich, wenn der Schnee unter den Stiefeln knirscht, die Luft eisig-klar ist und idealerweise auch noch die Sonne scheint. Aber diese feuchten und nebelverhangenen November- und Dezembertage finde ich schrecklich. Um halb acht ist es noch duster, spätestens um halb fünf schon wieder dunkel… das allein drückt auf meine Stimmung („Mehr Licht!“ waren angeblich Goethes letzte Worte; ich stimme ihm in diesem Punkt zu!).
Dabei mochte ich in meiner Kindheit diese Zeit besonders gern, weil sie erfüllt war von der Vorfreude auf Weihnachten. Wir haben in diesen Wochen gebastelt und gebacken, Lieder und Krippenspiele geübt, Grußkarten und Wunschzettel geschrieben, es war alles aufregend. Inzwischen bedeutet mir Weihnachten nicht mehr viel – ob das der Grund für den November- (und auch Dezember-)Blues ist??? Fehlt einfach etwas, auf das ich mich freuen kann?
A: Wir fuhren im November in meiner Kindheit an den Möhnesee zum Laubharken. Oma Soest hatte da eine Hütte mit einem großen Grundstück, auf dem bis heute uralte Eichen stehen, die einen Haufen Blätter abwerfen. Die Hütte war kalt und feucht innendrin, und draußen roch es nach modriger Erde und schweren nassen Blättern. Wir rechten, bis es dunkel wurde und wir die ersten Blasen an den Fingern hatte, freuten uns aber über die riesigen Laubhaufen, die mein Vater am nächsten Tag mit dem Hänger wegfuhr. Diese Tage waren für unsere Jagdhündin Senta ein Highlight, weil sie den ganzen Tag mit uns draußen verbrachte, ihre neugierige Nase immer wieder in die Laubhaufen drückte und sich zwischendurch – ob unserer Geschäftigkeit – davonstahl, um beim Nachbarn an den ersten Baum zu pinkeln oder die Spur eines Karnickels im nahegelegenen Wald zu verfolgen. Auch der herbe Geruch und Geschmack der unzähligen Eicheln, die wir uns als Tabakpfeifen in den Mund steckten, ist mir bis heute präsenter als jedes Parfüm, das ich mal in der Nase hatte. Meine Nase war in diesem dunklen und nebligen Monat – so im Nachhinein gefühlt – immer eiskalt, genauso wie meine Finger. Und trotzdem mochte ich den November, weil er ein Vorbote des Dezembers war, der diese magische und kerzenlichtvolle Vorweihnachtszeit einläutete.
M: Wann ist mir die Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit abhanden gekommen?, überlege ich grade. War es eine abrupte Veränderung oder ein schleichender Prozess? Und liegt es vor allem daran, dass ich mich vom Christentum und seinen Ritualen ganz abgewandt habe?
In meinen Zwanzigern hatte ich mit Weihnachten schon nicht mehr viel am Hut, die Tage „zwischen den Jahren“, wie es so schön (und falsch!) heißt, empfand ich als besonders langweilig, fast schon trostlos. Das änderte sich, als meine beiden Kinder zur Welt kamen. Plötzlich war Weihnachten wieder aufregend und voller Erwartung, ein Wunder. Diese Vorfreude hat mich regelrecht angesteckt und mich noch einmal zurück in die eigene Kindheit katapuliert. Ich habe damals zum Beispiel stunden- bzw. tagelang Schmuck für den ersten eigenen Christbaum gebastelt, den gibt es größtenteils heute noch (den Schmuck, nicht den ersten Baum!). Und jedes Jahr, wenn ich mit Sohn oder Tochter oder beiden den aktuellen Baum schmücke, erinnere ich mich daran, wie schön das war, Weihnachten mit kleinen Kindern. Und wie sehr ihre Freude auch mein Herz erwärmt hat.
A: Die Vorfreude auf Weihnachten hat bei Kindern etwas Zauberhaftes, ist voller Geheimnisse, Ungeduld und Erwartungen. Schon Anfang November kramte ich als kleines Mädchen meine Weihnachtsnoten von Bach, Händel und Brahms aus dem Schrank und spielte sie rauf und runter auf dem Klavier. Unser Haus war zwar längst nicht so üppig geschmückt wie das der unmittelbaren Nachbarn, die die uneingeschränkten Bastelkönige der Gasse waren, aber doch dezent mit Pergament- und Holzsternen und einer großen, schlichten Engelsammlung aus Keramik, die meine Mutter mit Kerzen aufstellte. Manchmal schlich ich mich in das eiskalte Schlafzimmer meiner Eltern im ersten Stock und lugte heimlich in den Kleiderschrank meiner Mutter, in dem die festlich verpackten Geschenke standen. Das Herz schlug mir bis zum Hals, wenn ich – vom schlechten Gewissen getrieben – die Treppe wieder runterhastete, und abends im Bett schwor ich dem Christkind, das niemals wieder zu tun und bis Weihnachten jeden Tag meiner Mama beim Spülen zu helfen.
Mit meinen Söhnen habe ich in der Vorweihnachtszeit tonnenweise Plätzchen gebacken und dabei Rolf Zuckowski! gehört, bis er uns aus den Ohren rauskam. Da meine Mutter keine Plätzchen backte, hatte ich Nachholbedarf und füllte diese Kindheits-Lücke jedes Jahr mit drei zusätzlichen Sorten.
M: Bei uns zuhause wurden Unmengen von Plätzchen gebacken, 12 – 15 Sorten, und von jeder Sorte mehrere Pfunde, denn die vielen alten und ledigen Tanten der Familie bekamen in der Vorweihnachtszeit Päckchen mit Selbstgebackenem und von uns Kindern aus Bienenwachsplatten handgerollten Kerzen. Eine eifrigere Bäckerin als meine Mutter war nur noch meine Großmutter, die nicht nur noch mehr und wesentliche kompliziertere Plätzchensorten buk – Anisplätzchen! Springerle! – , sondern es sich auch nicht nehmen ließ, jedes Jahr etwa 20 Stollen zu fabrizieren. Diese wurden dann nicht etwa im eigenen Ofen gebacken, sondern, sorgfältig abgedeckt, zum Bäcker getragen; warum, weiß ich bis heute nicht.
A: Stollen habe ich auch gebacken, als die Buben noch klein waren. Der Teig musste tagelang gehen, fieses Orangeat und Zitronat glänzte durch Abwesenheit, und der Stollen war beim Anschnitt butterweich und schmeckte köstlich. Leider ist mir das Rezept auf einem unserer Umzüge abhandengekommen, was sehr schade und gut zugleich ist, denn es war ein Riesenaufwand! Überhaupt war die Vorweihnachtszeit mit kleinen Kindern rückblickend megastressig, aber auch wundervoll. Wenn wir Heiligabend mit meinen Eltern, Brüdern und deren Familien dann endlich mit 12 – 14 Leuten und zwei Hunden unter unserem windschiefen und nadelnden Tannenbaum saßen, war ich meist fix und alle UND selig. Heute genieße ich die „stade Zeit“, wie mein Nachbar immer zu sagen pflegt, auf ganz andere Art und Weise. Und der Novemberblues hat – so schräg das auch klingen mag – einen nicht unwesentlichen Anteil daran.
M: Wieso du den Novemberblues genießen kannst, musst du mir bitte erklären! Und empfindest du die „stade Zeit“ wirklich als stad? Ich muss nur einmal in der Dämmerung am Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit entlanggehen, und schon erscheint mir diese Bezeichnung als Hohn. Allein diese Beschallung mit Weihnachtsliedern in Dauerschleife, vor der nicht mal gewöhnliche Supermärkte mehr Halt machen!
Als ich heute in der Post an der Leopoldstraße Briefmarken kaufen wollte, wurde ich Zeugin einer zunehmend unflätig und laut geführten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen um die 40, beide mit Paketen beladen; es ging darum, dass eine angeblich die Warteschlange gewechselt und sich dadurch vorgedrängelt hatte; einer der Schalterbeamten musste energisch schlichten. Also auch hier nix mit „stad“.
Ich kann mir nicht helfen, mir schlägt diese Zeit einfach aufs Gemüt, und es wird jedes Jahr schlimmer. Heute wieder den ganzen Tag kein einziger Sonnenstrahl. Ob ich es mal, wie von einer Freundin vorgeschlagen, mit Lichttherapie probieren soll?
A: Das ist einen Versuch wert, würde ich sagen! Denn Licht ist das Schlüsselwort: Ich versuche tatsächlich, das Licht in mir selbst anzuknipsen, weil es mir da draußen natürlich auch fehlt. Und ich hab mich entschieden, nicht mehr in Widerstand zu gehen mit diesem trostlosen November. Wie das funktioniert? Ab auf die Yogamatte, Augen zu, stillsitzen und schauen, was so kommt. Jede Menge! Viel Drama, viel Negatives. Und dann auch noch andauernd das Gleiche – zu mindestens 80%, wie die Hirnforschung wohl festgestellt hat. Spätestens nach dieser Erkenntnis hatte ich keine Lust mehr, immer über den gleichen Schmarrn nachzudenken – was ich natürlich immer noch tu! – aber ich nehme es bewusst wahr, beobachte es, und verschaffe mir so kleine Lücken.
Denn nach längerem Sitzen auf der Yogamatte (trotz allem anstrengend!) kommt tatsächlich etwas Licht in den dunklen Keller in mir, es wird heller, freundlicher, klarer. Mittlerweile gehe ich „unmeditiert“ nicht mehr aus dem Haus. Das gehört zur täglichen Reinigung, genauso wie das Zähne putzen. Erstaunlicherweise nehme ich seitdem hektische Menschen im Weihnachtsstress und Dauerbeschallung meist anders wahr. Es stört mich nicht wirklich, manchmal kann ich sogar darüber lachen. Und all das funktioniert bei mir in den dunklen Monaten besser, vielleicht auch weil der Rückzug hier sogar gesellschaftsfähig ist und ich mich nicht dafür entschuldigen muss.
M: Das mit dem Meditieren probiere ich seit ein paar Tagen auch aus. Im BR war ja im morgendlichen Fitness-Programm, an dem ich nach Möglichkeit gerne teilnehme, einmal wöchentlich ein Zen-Meister zu Gast. Beim ersten Mal war ich sehr skeptisch und dachte, das ist nichts für mich, habe mich dann aber doch drauf einlassen können, mich 20 Minuten lang durch eine Meditation führen zu lassen, und ich muss sagen: Es hat mir gutgetan! Ich konnte mich für eine Weile fallen lassen, viele in diesem Moment störende Gedanken ausblenden und entspannen. Hätte ich vorher nicht gedacht! Und wenn mich jetzt wieder mal der Blues überfällt, probiere ich einfach so eine Meditation wieder. Und bin dann tatsächlich für mindestens ein paar Stunden wirklich gelassener mit mir und anderen.
Jetzt warte ich nur noch darauf, dass die Sonne sich mal wieder zeigt, da war ja in den letzten Tagen Fehlanzeige. Wenn es so weit ist, werde ich, wenn irgend möglich, umgehend das Haus verlassen und mich ins Freie begeben, um reichlich Serotonin und Dopamin zu tanken. Dann werde ich die Zeit bis zum Frühling schon halbwegs überstehen…
A: Ja, dieser Spätherbst ist so dunkel, wie der Sommer hell war. Ich hab gestern ein Lichtermeer aus Kerzen in der Wohnung entzündet – das war wärmend und wohltuend. Und meine Playlist „Dance“ läuft im Moment auch verdächtig oft, denn Tanzen hilft bei mir immer! Und Räuchern! Das werde ich wieder exzessiv in den Rauhnächten betreiben und freu mich drauf. Alten Mief und schlechte Stimmung aus den Zimmerritzen entfernen mit Kardamon, Myrrhe, Rosmarin, Lavendel und natürlich Weihrauch, dem Klassiker unter den Ausputzern. Das hat natürlich in erster Linie eine symbolische Bedeutung und Kraft, die mich ganz eintauchen lässt in die dunkle Zeit zwischen den Jahren. Diese etwas merkwürdige Formulierung kommt meines Wissens übrigens aus der Differenz der zwölf Nächte (auch „die Zwölften“ genannt) zwischen der alten Zeitrechnung des Mondjahres und der aktuellen des Sonnenjahres und meint die Zeit zwischen Heiligabend und Dreikönig (in anderen Traditionen beginnen sie auch mit der Wintersonnenwende am 21.12. eines Jahres). Ich liebe ja altes Brauchtum, Rituale, Mythen, Sagen, Geistergeschichten – und davon gibt es in dieser Zeit so einiges, das mich zum Schaudern bringt. Und trotzdem kann ich die Finger nicht davon lassen…