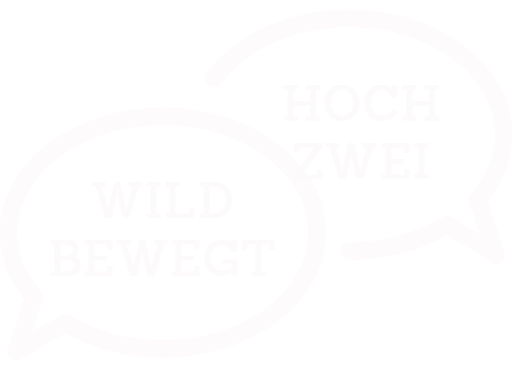M: Vergangene Woche wurde um die Ecke einer der letzten „öffentlichen Fernsprecher“ abgebaut. Natürlich braucht die heute niemand mehr, trotzdem wurde mir ein bisschen wehmütig zumute. Neuerdings mag ich es überhaupt nicht, wenn Dinge, die Zeit meines Lebens selbstverständlich waren, „einfach so“ verschwinden.
Zu meiner Zeit – jetzt klinge ich wie Oma, die vom Krieg erzählt, ich rede aber von den 70-ern – gab es noch nicht diese in den Telekom-Farben gehaltenen überdachten Telefonsäulen, sondern noch die rechteckigen gläsernen gelben Telefon-Zellen, schlichtes, klassisches Design, einfach schön (später wurden die Ecken abgerundet und mehr Plastik verbaut, das gefiel mir dann schon nicht mehr so). In einer Hängevorrichtung waren, zumindest in München, drei dicke Telefonbücher mit meist total zerfledderten oder zerrissenen dünnen Seiten verstaut, A-L, M-Z sowie das Branchenbuch. Der Hörer aus schwarzem Bakelit war, wie unser Biologie-Lehrer einmal schaudernd erklärte, ein gigantischer Tummelplatz von Viren und Bakterien und sollte, so seine Ermahnung, vor Benutzung unbedingt desinfiziert werden. Ob das jemals einer gemacht hat? Ich jedenfalls nicht.
Wieviele Stunden ich wohl in so einer Telefonzelle verbracht habe, die notwendigen Münzen abgezählt vor mir (ein Ortsgespräch kostete 20 Pfennig)? Noch länger habe ich vor ihr gewartet, denn natürlich war die Kabine immer dann besetzt, wenn ein besonders wichtiges Gespräch anstand, bei dem man so ungestört wie möglich sein wollte, denn sonst hätte man ja gleich daheim telefonieren können. Und wenn man dann endlich drinstand in dem ausnahmslos muffigen Kabuff – besonders herausfordernd war es, die Kabine nach einem Zigarrenraucher zu betreten – pochte garantiert irgendeine schlecht gelaunte alte Schachtel ans Glas und verwies mit hochgezogenen Augenbrauen auf das Schild an der Wand: „Fasse dich kurz!“ Oder sie riss gar die Tür auf und keifte „dauert’s noch lange?!?“ Die Wortwechsel, die sich daraus ergaben, waren selten jugendfrei.
Kennst du noch „richtige“ Telefonzellen? Und falls ja, welche Erinnerungen verbindest du damit?
A: Den Geruch! Nach kaltem Zigarettenqualm, modrigem altem Papier und der Hörer roch – mit Verlaub – nach Kotze. Aschenbecher aus diesem dunklen Kunststoff rochen auch so. Ekelhaft. Mir war immer ein bisschen schlecht in diesen gelben Zellen, ich hatte Platzangst und Sorge, dass jemand die Tür von außen zuhält und ich da nie wieder rauskomme. Deshalb hatte ich meist einen Fuß in der Tür, natürlich auch der frischen Luft wegen. Und das Geräusch der Münzen ist mir noch sehr präsent, die scheppernd in das Geldrückgabefach fielen, wenn man den schweren, übelriechenden Hörer unverrichteter Dinge wieder in die Gabel fallen ließ, weil man niemanden erreicht hatte. Manchmal war auch eine Münze weniger drin. Und ich habe Bilder von zahlreichen Herzen auf verschmierten Scheiben, „Fuck you-Sprüche“ und abgeblätterte Aufkleber mit „Atomkraft? Nein danke“ im Kopf.
M: Oh ja, diese Aschenbecher, die hätte ich fast vergessen! Sie waren idiotisch klein, so dass kaum drei Kippen reinpassten, und aus schwarzem Kunststoff, Bakelit, glaube ich, wie die Telefone. Bei Inbetriebnahme noch schwarz und glänzend und Plastikgeruch ausdünstend, waren sie schon nach wenigen Tagen von einem gräulichen und schmierigen stinkenden Film überzogen, die Kippen quollen über, Asche war überall verteilt. Rauchen in der Telefonzelle war echt eine Sauerei, das fand sogar ich, und ich hatte damals wirklich Nikotin im Blut.
Sich zu verabreden in Zeiten der Telefonzellen war aus heutiger Perspektive echt kompliziert, wir haben viel gewartet oder sind aneinander vorbeigelaufen. Und niemals würde ich heute noch so wie damals an einem knackig kalten Silvesterabend mutterseelenallein auf einem Bahnsteig mitten in der oberbayrischen Pampa stranden, weil ich auf dem Weg zu Freunden an den Tegernsee und einer wilden Party in Holzkirchen falsch umgestiegen war. Ich marschierte beim Warten auf den Bummelzug zurück fast zwei Stunden auf dem Bahnsteig auf und ab, um nicht einzufrieren, es gab ein klammes Holzhäuschen mit Bank und – außer einem vergilbten Fahrplan – NICHTS! Natürlich auch keine Telefonzelle.
Es wurde trotzdem noch eine schmutzige Fete in dieser Nacht. Und ich hatte was zu erzählen.
A: Was ich ausnahmslos niemandem erzählte als Jugendliche, waren meine sehnsuchtsvollen Minuten in einer dieser gelben Zellen, die ich, hektisch im dicken Telefonbuch blätternd, damit verbrachte, die Nummer eines Jungen zu finden, in den ich unsterblich verliebt war. Der Plan war, nur mal zu hören, wie er seinen Namen sagt und dann ganz schnell aufzulegen. Die Seiten mit „L“, die ich suchte, waren in der ersten Telefonzelle teils rausgerissen und unvollständig und ich musste zur nächsten laufen, die nicht grad um die Ecke war. Dafür waren die L-Seiten vollständig und ich konnte mit nervösen Fingern eine mir unbekannte Nummer wählen, die ich danach über Jahre nicht mehr vergessen habe. Nach dem ersten Freizeichen verließ mich der Mut und die Münzen fielen scheppernd wieder in das Rückgabefach, nachdem ich panisch den Hörer eingehängt hatte. Zwei Versuche später hielt ich dann herzklopfend durch, bis ich eine kindliche Stimme hörte, die der kleinen Schwester von „Lui“, wie wir ihn schwärmerisch nannten, gehörte. Die verwöhnte Zimtzicke fragte drei Mal, wer denn da am Telefon sei? Ich hasste sie Monate später noch dafür, dass SIE den Hörer abgenommen hatte und hielt paralysiert die Luft an, um ihr nicht entgegenzuschleudern, was für eine blöde Kuh sie doch sei. Irgendwann legte sie auf und ich stand schnappatmend in dieser trostlosen Zelle mit dem Hörer in der Hand, aus dem das monotone „Besetztzeichen“ ertönte. Mir war ganz elend zumute, ich rannte nach Hause und dachte mir – für den Fall das mich jemand gesehen hatte – eine abstruse Geschichte aus, die erklären sollte, weshalb ich mich in dieser Gegend rumgetrieben hatte, in der ich sonst nie war.
M: So ähnliche Erlebnisse hatte ich auch damals, denn bei uns daheim war es praktisch unmöglich, ungestört und – vor allem! – unbelauscht ein Telefonat zu führen: Der Apparat stand im Flur, wo ständig irgendjemand durchlatschte oder -rannte oder -lärmte und meine Mutter von der Küche aus mithören konnte, was sie auch ungeniert tat; also fiel das Telefonieren mit Freundinnen oder – noch schlimmer! – Freunden flach, wenn ich mich danach nicht den inquisitorischen Fragen – „Wer war das? Was wollte der oder die? Von welchem Treffen habt ihr geredet?“ etc. – stellen wollte. Noch schlimmer war es, auf einen Anruf zu warten. Meistens hatte ich dafür Zeiten verabredet, in denen ich halbwegs sicher zu sein meinte, dass alle im Haushalt anderweitig beschäftigt wären (besonders beliebt war hier die Viertelstunde der Tagesschau, die meine Eltern niemals versäumten), was aber fast nie klappte. Entweder hing jemand anders am Telefon, oder neugierige kleine Geschwister steckten den Kopf in den Flur… es war zum Verzweifeln!
Ich habe damals glühend amerikanische Teenager beneidet, denn bei denen konnte man von einer phone booth nicht nur telefonieren, sondern auch angerufen werden, was in den deutschen Telefonzellen ja nicht möglich war, zumindest nicht in meiner Jugend.
A: Ich hatte mal einen wilden Verehrer aus meiner Heimatstadt, der aus dem Nichts heraus 200 km fuhr, um an unserer WG-Klingel in Köln Sturm zu klingeln, der altmodische Telegramme verschickte, 100 rote Langstiel-Rosen (die ich in meinem Mini -WG-Zimmer in Köln nirgends stellen konnte, geschweige denn eine Vase in der Größe hatte) und eine Telefonzelle in den Vorgarten einer Angebeteten stellen ließ mit einem riesigen Schild an der Tür „RUF MICH AN!“. Die Telefonzelle stand Gott sei Dank nicht im Vorgarten meines Elternhauses – mein Vater wäre wahrscheinlich ausgerastet. Oder nachhaltig beeindruckt gewesen, kaufte er doch seine TV-Geräte auch in seinem hippen Laden, in dem es HiFi-Ausstattungen gab, die wohl keinen Mann in unserer Kleinstadt kalt ließen. Ich glaube, der Liebeskranke musste die Telefonzelle noch am selben Tag wieder abtransportieren lassen. Jeder wusste natürlich, dass er es war und etwas zu dementieren oder sich gar zu verleugnen, war so gar nicht sein Stil.
M: Die Tatsache, dass es für uns damals quasi unmöglich war, überall und vor allem: ungestört zu telefonieren, hatte natürlich auch eine andere, für uns positive, Seite: Wir konnten auch nicht erreicht werden! Hatten wir mal das Haus verlassen, war es für unsere Eltern schier unmöglich, unsere Spuren zu verfolgen und festzustellen, ob wir uns wirklich da aufhielten, wo wir behaupteten zu sein. Zumal sie die meisten unserer Freunde nicht kannten, also uns auch nicht hinterhertelefonieren konnten; sowas wie z.B. Klassenlisten mit sämtlichen Kontaktdaten gab es seinerzeit nicht. Wir waren also in gewisser Weise wirklich unbeobachtet und konnten unseren Eltern die größten Bären aufbinden, wo und mit wem wir unterwegs waren, und was wir dort machten. Das ist für die Kinder von heute praktisch unmöglich, da tun sie mir richtig Leid. Die Mutter eines 12-jährigen erzählte neulich in Gesellschaft ganz unschuldig, dass sie jeden Schritt ihres Sohnes über die Tracking-Funktion des Handys verfolgen könne und das auch immer wieder tue, „zur Sicherheit“. Sie fand das total normal.
Als meine beiden im Teenager-Alter waren, hatten sie noch keine eigenen Handys – ich bin da sehr old-school – , konnten mich also auch gut hinters Licht führen. Was sie so alles angestellt haben, erzählten sie mir später. So erfuhr ich zum Beispiel, dass die angebliche Pyjama-Party in Wahrheit eine Kiffer-Fete war, und dass die behauptete Mathe-Lerngruppe sich zum Chillen und Schwimmen am Eisbach traf – natürlich ohne Schulbücher!
A: Herrlich, das Leben ohne Hubschraubereltern! Meine Jungs konnten sich auch ohne Peilsender rumtreiben und haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Als Jugendliche waren sie dann schon mit Handy ausgestattet, aber die waren meist zum richtigen Zeitpunkt auf stumm geschaltet oder der Akku war leer. Jedes Mal, wenn ich begann, mir ernsthaft Sorgen zu machen, hab ich mich gezwungen, an meine Kindheit und Jugend zu denken. Da war natürlich auch alles, was die Eltern nicht wussten, mit großem Abstand am aufregendsten. Und meine Mutter pflegte in der Regel zu sagen: Wenn du nicht anrufst, kann auch nichts passiert sein. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, mich eigenhändig bei meiner ersten großen Liebe mit dem Radl abzuholen, als sie spitz gekriegt hatte, dass ich nicht – wie verabredet – bei meiner Freundin war. In ihrer heiligen Mission, mich auf keinen Fall zu früh meine Unschuld verlieren zu lassen, war sie gnadenlos. Und mir war das entsetzlich peinlich!
Merkwürdigerweise kann ich mich aber an kein einziges Telefonzellen-Telefonat mit meinem ersten, deutlich älteren Freund erinnern. Wir haben eigentlich gar nicht viel telefoniert, wir haben uns einfach (auch gern heimlich) gesehen, gesprochen, geküsst… Und wir haben schreckliche Sehnsucht gehabt, wenn er oder ich auf Klassenfahrt war oder – noch schlimmer – im Urlaub für drei Wochen. Dann hab ich sein Passbild, das er mir in einem rechteckigen Plastikrahmen geschenkt hatte, aus der Nachttischschublade geholt und mich zwei Jahre später gewundert, dass ich in all der Zeit nicht gesehen hab, was für eine rote und verrotzte Nase er auf dem Bild hatte. Liebe macht einfach blind. Und Telefonzellen gibt es leider nicht mehr – sie werden mir irgendwie fehlen, auch wenn ich sie in den letzten Jahre nicht wirklich vermisst habe.