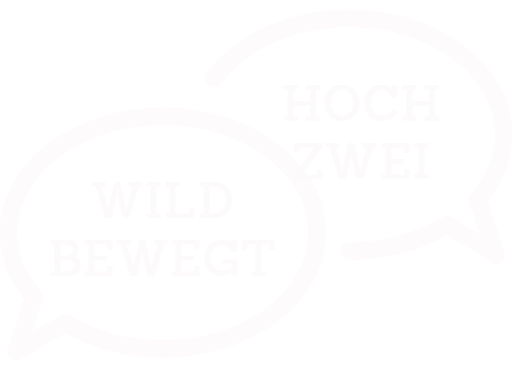M: Gestern im Bus unterhielten sich hinter mir zwei etwa 20-jährige junge Männer, die offenbar mit noch einem dritten eine Reise planten, bei deren Vorbereitung es Schwierigkeiten gab, denn „das Auto von dem seinem Vater kriegen wir nicht, weil er wegen dem Scheiß-Coronavirus nicht will, dass wir überhaupt fahren.“
Ist der Genitiv noch zu retten? Dass der Dativ dem sein Tod ist, wissen wir ja nicht erst seit der Spiegel-Online-Kolumne bzw. dem Buch; seine Vernichtung findet mittlerweile nicht nur in der Alltagssprache statt, sondern auch in TV, Radio und Zeitung. „Wegen dem Stau“ lese und höre ich ständig – wobei sogar der Duden inzwischen kapituliert hat und diesen Dativ erlaubt; nicht ganz so oft, aber auch immer wieder wird zum Beispiel „den Toten gedacht“, was ich wirklich schlimm finde.
Nicht so wichtig, findet zum Beispiel mein Sohn, der des Öfteren die Augen rollt über meine sprachliche Pingeligkeit und das Argument ins Feld führt, dass sich Sprache im Lauf der Zeit eben verändert. Klar tut sie das. Aber muss das zwangsläufig bedeuten, dass sämtliche Rechtschreib- und Grammatikregeln (von der Zeichensetzung ganz zu schweigen) ignoriert werden? Und dafür schreckliches „Denglisch“ überhand nimmt? Ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich am Tag zwanzigmal höre „das macht Sinn“, knirsche ich mit den Zähnen.
A: Merkwürdigerweise reagiere ich auch im Mundraum auf diesen bösen Dativ. Im Übergang zwischen Zähnen und Zahnfleisch verspüre ich so ein helles Ziehen. Zu meinem großen Erstaunen fühlt es sich dort genauso an, wenn jemand aus einem Wollpullover diese kleinen fiesen Filzbommel rauszieht. Warum das bei mir bei ähnlich konditioniert ist? Keine Ahnung!
Im Rheinland fing es schon im Kindergarten an. Da hallten beim Abholen der Jungs immer die gleichen zwei Wörter durch den Eingangsbereich, in dem es hoch herging: WEM IST… die Jacke, der Regenmantel, der Rucksack? Oder eben im Plural: Wem sind die Gummistiefel? Diesen immer wiederkehrenden Schmerzen war ich – die Tochter eines westfälischen Deutschlehrers – also knapp zwanzig Jahre in regelmäßigen Abständen ausgeliefert. Und beim Bäcker ging es dann in die Fortsetzung: „Tun Sie mir noch ein Weckchen!“ hieß es da in aller Selbstverständlichkeit. JAJA! Jetzt möchte ich gern mal deine Gesichtszüge sehen!
Die Besitzverhältnisse im Rheinland werden also im Dativ geklärt und beim Bäcker tut man sich bestellen und geben. Als meine Jungs das widerstandlos inhaliert hatten, habe ich die ersten Jahre tapfer korrigiert – mal mehr und mal weniger geduldig. Als sie dann den Unterschied zwischen Kölsch und Hochdeutsch zumindest theoretisch verstanden hatten, habe ich nicht mehr verbal berichtigt, sondern nur noch das Gesicht – ob dieses hellen Ziehens im Mund – verzogen. Inzwischen wissen sie, dass sie immer etwas in der Hand haben, womit sie mich ärgern können. Und ich hoffe inständig, dass ich nicht eines Tages genau in dem Moment einen Herzinfarkt kriege, wenn der kölsche Dativ mein Gesicht ungebremst in Schieflage manövriert. Das sollte doch bittschön nicht der letzte Gesichtsausdruck sein, mit dem ich diese Welt verlasse.
M: Lustig, dass wir beide offenbar sprachlich ähnlich sozialisiert wurden: In meinem Elternhaus wurde auf grammatikalisch korrektes Hochdeutsch sehr geachtet, der Gebrauch des falschen Dativs wäre zum Beispiel umgehend freundlich korrigiert worden. Uns wurde auch sehr viel vorgelesen zu Hause, und Bücher gab es massenweise. Mich hat das geprägt, dieser sorgfältige und sehr bewusste Umgang mit der Sprache. Was ich sorgfältig nenne, finden natürlich andere penibel und auch kleinkariert. Ich habe viele Jahre lang ein ganzes Autoren-Team mit meiner Kritik traktiert und wurde dafür „Sprachpäpstin“ genannt, ein Ausdruck, den ich nicht unbedingt positiv werte.
Mir ist Sprache so wichtig, dass es mir weh tut, wenn sie verhunzt wird. Ebenso schlimm wie fehlerhafte Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik finde ich falsche Metaphern wie geplatzte Hutschnüre, oder Fremd-Wörter wie Papyrussieg oder cora publicum. Und dann so Flach- Ausdrücke wie „die Seele baumeln lassen“ oder „da bin ich ganz bei dir“, das ist für mich auch so eine Art sprachlicher Missbrauch.
Dagegen kann mir – noch immer und immer wieder – ein Satz, den ich lese, die Tränen in die Augen treiben, weil mich die Schönheit seiner Sprache so berührt.
Übrigens: Entgegen deiner Erwartung amüsiert mich die Sprechweise der Rheinländer immer sehr, wenn ich sie höre. Überhaupt habe ich mit den Irrungen und Wirrungen der Dialekte kein Problem; wenn mich hierzulande einer auffordert, ihm doch bitte „der Butter“ zu geben, zucke ich gar nicht zusammen. Merkwürdig eigentlich.
A: Dialekte sind spannend, witzig, sagen viel über die Menschen, die sie sprechen und schaffen sofort Atmosphäre. Ich kann noch heute diesen Trinkspruch der Friesen auswendig, der mit „Ick seh Di. Dat freit mi. Ick sup Di to. Dat do…“ beginnt, weil ich als Kind mit meiner Mutter im Sommer immer an den Jadebusen fuhr und am Ende des Urlaubs dann ein Offizieller aus der Kurstadt vorbeikam und mit meiner Mutter und Freundin feierlich auf das neue Jubiläum anstieß. Den Schluck aus dem Löffel plus Anstecknadel gab es aber nur, wenn man regelmäßig über Jahre als Nordsee-Urlauber wiederkehrte. Die Menschen von der Küste sind mir dabei sehr ans Herz gewachsen!
Im Friesischen gibt es ja auch diese herrlichen Verknappungen in der Sprache. Auf ein „Danke“ hört man dort „Da nich für“ statt eines langatmigen „Dafür brauchst du dich nicht extra zu bedanken“. Ähnlich kurz halten es ja auch die Bayern mit ihrem „Passt scho!“
In meinem ganz persönlichen sprachlichen Nord-Süd-Gefälle sehe ich da durchaus Parallelen, was die Maulfaulheit betrifft. Es wird bei den Nordlichtern, den Süddeutschen und auch den Ostwestfalen meist nicht viel Gewese gemacht um die Dinge, die gern erledigt werden.
Ähnliches drücken die Söhne vermutlich mit „Kein Ding“ (mal mit, mal ohne „Digga“) aus. Und das klingt dann ganz verdächtig nach einer sehr freien Übersetzung von „Not a big deal“, „No problem“ oder „No biggie“.
M: Mein Sohn macht mich mit etwas anderem narrisch: Abkürzungen! Und zwar nicht die guten deutschen wie „bzw.“ oder „vllt.“, sondern mit mir völlig unbekannten. „Wtf“ kenn ich ja grade noch, auch an „btw“ hab ich mich gewöhnt, und dass „kp“ einfach „kein Plan“ bedeutet, aber als ich vor einiger Zeit auf eine Frage meinerseits eine Nachricht bekam, „tbh, weiß ich nicht“, war ich wirklich ratlos. Und nach einigem Rätselraten genervt. „tbh?“, hab ich geschrieben, „Du musst bitte deutsch mit mir sprechen!“ Postwendend kam die Antwort: „to be honest“. Aber die hatte nicht mein Sohn geschrieben, sondern meine Tochter.
Was mir in letzter Zeit übrigens auch wieder verstärkt auffällt: Wie schlampig viele Mails geschrieben sind. Es gibt in meinem Umfeld etliche Leute, die ganz wunderbar lesbare und verständliche Mails schreiben, aber die Mehrzahl nimmt es nicht so genau damit, was sie so raushaut. Da fehlen halbe Sätze, da sind 2 – 3 Schreibfehler pro Zeile der Durchschnitt, manche machen wilde Formatierungen, einiges ist einfach nicht zu verstehen und erfordert eine Nachfrage. Als wir uns noch Briefe geschrieben haben oder Karten – ja, haben wir! Und ich trauere dieser Zeit hinterher! – haben wir uns mehr Mühe gegeben, glaube ich. Mich stört das. Ich habe von meinen Eltern gelernt, dass man einen Brief nach dem Schreiben noch mal durchlesen soll, bevor man ihn eintütet; mach ich immer noch, ebenso mit Mails. Und entdecke auch in meinem digitalen Geschreibsel einige Fehler; manche sind lustig, andere wären ziemlich peinlich und könnten Missverständnisse provozieren.
Und da ich schon mal am Nörgeln bin: Wieso nutzt eigentlich kaum jemand die Rechtschreibprüfung in Word? Ich finde die eigentlich ziemlich gut und hilfreich und nutze sie bei allen längeren Texten – ich glaube, du machst das auch, oder? Orthographie macht sie astrein, finde ich, und ein bisschen Grammatik kann sie auch. Nur von Zeichensetzung hat sie kp, tbh.
A: Diese Rechtschreibprüfung ist ungemein praktisch, ja! Weil sie natürlich auch gschlamperte Tipp-Fehler rot unterschlängelt. Erstaunlicherweise wird dieses nützliche Tool aber wenig von den Studenten genutzt, deren Facharbeiten ich lektoriere. Auch diese „Laissez-Faire“-Einstellung zu einem verständlichen und vor allem grammatikalisch sauberen Satzbau begegnet mir häufig. Das Anstrengende dabei ist, dass diese Fehler sich so etabliert haben, dass erst die x-te Anmerkung meinerseits zu einer ersten sichtbaren Veränderung führt – meist so nach der dritten Arbeit, die ich in Folge korrigiere…
Diese Beobachtung bestätigt mich in meinem empörten Durchgreifen bei den Söhnen vor vielen Jahren in der Grundschule. Die sollten die deutsche Sprache nach Gehör lernen und schrieben dann solche Sätze wie: „Dea hunt beld laud.“ War damals Trend und vom Kultusministerium durchgeboxt! Es war eine Katastrophe, was die Jungs an Wörtern und Mini-Texten mit nach Hause brachten, die ich als Mutter dann auch noch belobigen sollte, EGAL was da auf dem Papier stand. Und das, was in der ersten Woche richtig war, war in der darauffolgenden falsch. Bis dann irgendwann das richtige Wort erlernt wird, weil angeblich bestimmte Regeln verinnerlicht werden. Zum Beispiel die Endung eines Wortes durch die Bildung des Plurals zu erkennen: Der Hund – die Hunde. So die Theorie.
Ich habe mich nach den ersten Wochen strikt geweigert und habe eigenmächtig meine alte, schwer verrufene Methode zu Hause angewandt. Ab da war ich die böse Mama, die voll blöd rummeckert und viel dümmer ist als die Klassenlehrerin. Erst in der vierten Klasse war ich dann allmählich wieder rehabilitiert, weil auch beim Ministerium und den armen Lehrerinnen – die zum Großteil nie wirklich überzeugt waren – Zweifel an der neuen Methode aufkamen.
Vielleicht schreibt aber der Jüngste – aufgrund dieser traumatischen Erfahrung mit der doofen Mama – ziemlich saubere WhatsApp-Nachrichten? Und der Ältere zwar alles klein, aber zumindest richtig?
M: Deine Jungs sind in NRW zur Schule gegangen, meine Kinder in Bayern – da gab es solche Experimente mit der Rechtschreibung natürlich nicht. Aber wie auch immer: Orthographie haben sie alle vier trotzdem gelernt! Was meiner Meinung nach auch sehr daran liegt, dass sie große Leser sind, und sich die Schreibweise vieler Wörter visuell eingeprägt haben. Ich mach das übrigens heute noch so: Wenn ich bei einem Wort unsicher bin, schreib ich es auf – und weiß dann sofort, wie es richtig ist, auch ohne Rechtschreibprüfung, nur vom Anschauen her.
Was sprachliche Feinheiten angeht, so lerne auch ich immer noch was dazu: In meinem Verlag gibt es einen Korrektor, der ganz am Schluss, wenn das Manuskript eigentlich komplett fertig ist, noch mal drüber geht. Und er findet eigentlich immer noch was, egal, wie sorgfältig meine Lektorin redigiert hat (und sie ist wirklich sehr penibel!). Er fragt sich dann, sehr vorsichtig und höflich, ob dieses eine Adjektiv wirklich genau die Befindlichkeit der Figur trifft, ob es nicht an anderer Stelle eine passendere Redewendung gäbe und ob mir bewusst sei, was eine bestimmte Handlung für Konsequenzen hat. Ich bin immer sehr beeindruckt davon, wie unglaublich sorgfältig dieser Mann mit der Sprache und ihren Möglichkeiten umgeht. Und dann freut es mich besonders, wenn er am Ende ein Kompliment zum Manuskript macht und schreibt, dass es ihm gefallen hat; das ist dann ein Lob, das mich für den Rest des Tages trägt. Persönlich kennengelernt habe ich ihn noch nicht, ich bin aber durchaus neugierig, denn ich frage mich oft, ob und wie sich der sprachliche Umgang auf den Charakter und die Verhaltensweisen einer Person auswirkt – oder anders ausgedrückt: DENKT so ein Mensch auch präziser als andere?
A: Ich stelle mir unter dem Verlags-Korrektor einen sehr achtsamen Menschen vor, der neben seiner lupenreinen Korrekturarbeit auch zwischen den Zeilen liest, den Tonfall eines Satzes mitdenkt und sich augenscheinlich intensiv mit deinen Figuren beschäftigt. Sonst würde er vermutlich nicht nach stimmigen Adjektiven fragen, sondern sich rein auf die Orthographie beschränken, was ja eher schulmeisterlich wäre. Und vielleicht ist das Präzise, das du erwähnst, auch eine gewisse Detailverliebtheit? Denn am Ende wird unsere Arbeit ja immer auch von unserer inneren Haltung der Sache gegenüber geprägt. Und die schwingt in deiner Beschreibung des Korrektors deutlich mit.
Wenn ich eine Facharbeit zu einem beliebigen Thema lektoriere, blitzt diese innere Haltung der Autorin/des Autors gegenüber der eigenen Arbeit auch durch. Viele Rechtschreibfehler und fehlende Interpunktion sind gern auch mal ein Hinweis auf wenig Enthusiasmus oder pure Langeweile. Ich sage den Studenten dann immer: Wenn ihr als Dozenten solche Texte lesen müsstet, erledigt ihr das auch nur halbherzig und werft sie dann ganz fix wieder zurück auf den großen Stapel. Hinzu kommt, dass man als Leser ja ständig im Lesefluss gestört wird und sich im eigenen Kopf – in der Synapse nebenan – plötzlich ein entnervter Bandwurm-Monolog über mangelnde Arbeitsmoral und schlampige Arbeitsweise entspinnt. Es ist also nicht nur frustrierend für den Leser, sondern führt auch unweigerlich zu einer schlechten Benotung. Bei der mitgelieferten Begründung der Dozenten für die erteilte Note sind mir aber auch schon echte Rechtschreib-Klopper begegnet, die leider ebenfalls auf eine eher schlampige Haltung der eigenen Arbeit gegenüber hinweisen. Mein Credo wäre also: Eine gewisse Wertschätzung für die deutsche Sprache macht deutlich mehr Freude beim Lesen, Schreiben, Zuhören UND Reden!