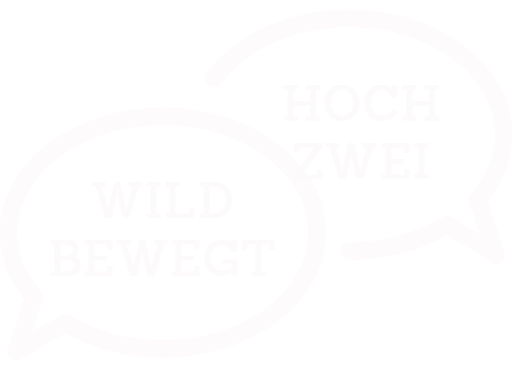A: Am letzten Wochenende gab es bei uns Fingernudeln. Die konnte niemand besser als meine Münchner Schwiegermutter. Als die Jungs noch kleiner waren, standen sie an Top One der Wunschliste für Lieblingsgerichte. Wenn wir aus unserer Wohnung über den Hof in die Wohnung der Schwiegereltern gingen, konnte man sie schon riechen. Im Hausflur musste man dann nur der Nase nach gehen, um die richtige Tür zu finden.
Die ersten brutzelten schon in der Pfanne und auf dem Küchentisch lag das große Holzbrett, auf dem der zweite Teil des Kartoffelteiges, in einer länglichen Rolle geformt, bereitlag. Die Jungs krempelten sich die Ärmel ihrer Sweatshirts hoch, hockten sich auf die Eckbank und griffen mit ihren hoffentlich gewaschenen Fingern beherzt in den Teig. Dann wurde probiert, geleckt und abgeschmeckt, in den Händen eine erste Kugel aus Kartoffelteig geformt und auf dem Brett schließlich ein länglicher Wurst-Finger. Wenn er nicht gut aussah, kam er wieder in die Hände, die nach der dritten Kugel meist schon schwer klebrig und angebatzt waren. Also musste mehr Mehl her, das sich in mal größeren, mal kleineren weißen Wolken über die Polster der Eckbank, die Shirts der Jungs und allmählich auch auf Tisch, Anrichte und Oma legte.
Oma war das egal. Sie hatte eine Schürze um und genoss es, ihre Buben fröhlich knetend, lachend und hungrig in ihrer brutzlig warmen Küche um sich zu haben. „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, sagte sie dann gern. Das war auch ihr Kommentar zu meiner zweiten, doch recht eng getakteten Schwangerschaft.
Unsere Fingernudeln am vergangenen Wochenende waren gut, aber sie waren natürlich nicht so wie bei Mutter (wie ich sie nannte, weil für sie gar nichts anderes in Frage kam). Wir hatten das gleiche Zeitproblem wie sie, weil man mit zwei großen Pfannen voller Fingernudeln mit dem Wenden nicht mehr hinterherkommt. Unsere Fingernudeln waren also – dem Himmel oder Mutter sei Dank – genauso wie bei ihr, obrennt. Die erste, die ich direkt aus der Pfanne stibitzte und – weil viel zu heiß – zwischen den Händen jonglierte, beamte mich in Mutters Küche, in der zu den Mehlwolken dann auch noch die Geruchsschwaden der „Obrennten“ (die einfach die Besten waren!) dazukamen. Es war ein herrliches Déjà-vu und ließ dieses unvergleichliche Gefühl einer Art Suppendampfseligkeit (die ich auch aus Günter Grass‘ „Blechtrommel“ und dem „Butt“ kenne) in mir aufsteigen.
M: Oh ja – Fingernudeln, die gab es bei uns daheim auch öfter. Meistens am Monatsende, wenn das Geld schon etwas knapp war. Man braucht ja nicht viel dafür: Kartoffeln, Mehl, Salz, Eier, Fett, fertig. Kartoffeln hatten wir massenweise in unserem riesigen, schlecht beleuchteten und modrig riechenden Keller, im Garten standen viele Apfelbäume, deren Erträge im Herbst zu Kompott und VIEL Apfelmus verarbeitet wurden, Eier brachten die Bauern als Geschenk mit, wenn sie ein Anliegen an meinen Vater hatten (manchmal auch Hühner, und einmal sogar zwei Tauben, die baumelten lässig am Gürtel des Bauern, natürlich noch nicht gerupft). Es war also nicht nur ein bei uns Kindern sehr beliebtes Essen, sondern kostete auch nicht viel. Mein Vater aß nichts oder nur wenig davon, süße Hauptgerichte waren überhaupt nicht sein Ding; er bekam also einen Extra-Teller mit Fleisch oder Fisch, Kartoffeln und Gemüse.
Normalerweise aßen wir im Esszimmer, halbwegs gesittet. Wenn es aber Fingernudeln oder Reiberdatschi gab, hockten wir in unserer großen Küche an dem langen Tisch (der unter der Platte eine Schublade hatte, in die zwei große Waschschüsseln eingelassen waren) und warteten, das Besteck schon in den Fäusten, gierig auf die nächste Ladung, die meine Mutter in zwei riesigen schwarzen Gußeisenpfannen auf dem Herd briet. Mitessen konnte sie natürlich nicht, Fingernudeln für Minimum acht, meistens aber mehr Leute gestatten keine Pause. Sie hechtete also, erstaunlich gut gelaunt, erhitzt zwischen Tisch und Herd und Pfannen hin und her, schaufelte Unmengen von Fingernudeln auf drängend hingehaltene Teller. Wenn endlich alle genug hatten und sie selber auch halbwegs entspannt hätte essen können, mochte sie meistens nicht: „Ich bin vom Kochen schon satt.„
A: Ich liebe Reiberdatschi! Wenn meine Mutter morgens den Reiberdatschi-Tag ankündigte, lief ich eilig von der Schule nach Hause, schmiss schnell meinen Schulranzen in die Ecke, krempelte meine Ärmel hoch und schraubte den Kartoffelwolf aus Eisen am Tischrand in der Küche fest.
Meine Mama hatte die Kartoffeln meist schon vorgeschält mit einem extra scharfen Hümmelchen, wie es in meinem Elternhaus heißt: Ein kleines, leicht gebogenes und richtig scharfes Küchenmesser mit Holzgriff, das nicht rostfrei ist und auf keinen Fall in die Spülmaschine darf! Bei uns saßen mit uns meist mindestens drei hungrige Männer am Tisch, und deshalb wurden die dicken Kartoffeln aus dem Keller geholt, die mit dem Hümmelchen ratzfatz – in einer langen Kartoffelschalenspirale, die in die Spüle fiel – geschält waren. Ich drückte sie dann durch diesen Reibewolf, der immer wieder aus der Tischverankerung rutschte. Manchmal musste ich mein ganzes Körpergewicht auf die Kurbel geben, damit die Reibe die festen und rohen Kartoffeln durchdrehte. Wenn ich fertig war, tat mir der rechte Arm weh oder ich war mit dem Kinn oder Arm unschön auf der Reibe gelandet, weil die Kurbel plötzlich zu schnell nachgab. Zum Anbraten wurde die Dunstabzugshaube angeworfen und die Küchentür geschlossen, damit nicht das ganze Haus roch.
Die ersten Reibekuchen, die meine Mutter – wie deine – auf dem großen Teller kredenzte, waren die besten. Bei uns gab es sie mit selbstgemachtem Apfelkompott. Köstlich! Wenn meine Mama die letzte Pfanne befüllt hatte, riss sie schon mal das Küchenfenster auf, setzte sich dann endlich zu uns und aß ihre eigene Portion. Meistens verkündete sie vorher noch: „Die Schlacht ist geschlagen!“ Herd und Küche boten tatsächlich den Anblick eines Schlachtfeldes, vermutlich gab es sie deshalb nicht allzu oft.
Und wenn noch welche über waren, aßen wir sie abends kalt auf Brot oder dick mit Rübenkraut bestrichen.
M: Bei uns daheim wurden die Kartoffeln für Reiberdatschi und für rohe Knödel auf einer großen Reibe zerkleinert, das machte entweder meine Mutter oder meine Großmutter. Wir sahen dabei immer fasziniert und angespannt zu, denn es blieb nicht aus, dass – vor allem bei meiner sparsamen Großmutter, die auch das letzte Kartoffelstückchen verarbeitete – die Fingerkuppen dran glauben mussten und ein bisschen Blut in die geriebenen Kartoffeln geriet….
Gab es bei Euch auch ein Kinder-Trostessen? Bei uns war es Schokoladensuppe! Die machte meine Mutter aus Puddingpulver, man nimmt dafür einfach die doppelte Menge Milch, außerdem noch ein bisschen Extra-Kakao für den intensiven Geschmack. Ich habe die sehr geliebt (und esse sie auch heute noch manchmal!); ob meine Geschwister die auch so mochten, weiß ich nicht mehr. Immer wenn ich großen Kummer oder mich verletzt hatte, bekam ich eine Portion davon – und danach ging es mir tatsächlich gleich besser! Ob das am in der Schokolade enthaltenen Serotonin oder Theobromin lag? Jedenfalls half es!
Das letzte Mal hat mir meine Mutter Schokoladensuppe gemacht, als ich fürchterliche Halsschmerzen hatte und alle Essensangebote ausschlug, weil das Schlucken so weh tat. Die Suppe aber rutschte, sämig und weich und warm und süß, ganz von selber den Hals runter.
Übrigens halte ich diese Tradition aufrecht: Auch meine Tochter bekommt in kummervollen Momenten dieses Trost-Essen. Das kommt gottseidank nicht allzu häufig vor, aber wenn sie, wieder ganz kleines Kind, fragt: „Machst du mir Schokoladensuppe?“, dann weiß ich: Es ist ernst! Und manchmal tröstet ein Essen besser als Worte.
A: Ein rituelles Trost-Essen habe ich nicht in Erinnerung. Was bei uns aber immer als heilsam, nährend und tröstend gilt, ist eine heiße Suppe. Zum Frühstück schwören meine Eltern auf eine warme Milchsuppe mit Haferflocken und Rosinen. Die essen sie bis heute und speziell mein Vater ist fest davon überzeugt, dass er deshalb so alt ist, wie er ist.
Mittags gab es dann im Winter oft herzhafte Suppen-Varianten. Hühnersuppe und zahlreiche Varianten von Eintöpfen: Grüne-Bohnen-Eintopf, Linseneintopf, Erbsensuppe… – gern mit geräucherten Würsten, die ich meist nicht aß, weil mir die Tiere so leid taten.
Was den Bayern das Bauerngeselchte ist, ist den Westfalen der Knochenschinken und eben diese speziellen Würste, die in früheren Zeiten zum Räuchern in den Wiemen hingen, also im höheren Teil der Decke im Küchenbereich oder über dem offenen Kamin alter Bauernhäuser. Für diesen ganz persönlichen „westfälischen Himmel“ sind die Westfalen ja bekannt und meine Oma Soest und ich schmuggelten die – unverkennbar nach Heimat schmeckenden – Schinken und Würste bis in die USA zur ausgewanderten Verwandtschaft. Beim Ausfüllen der Zollerklärung im Flieger bin ich immer knallrot geworden. Die Frage des Zollbeamten nach eingeführten Lebensmitteln bei der Einreise beantwortete deshalb meine Oma in stoischer Gelassenheit mit einem einfachen: „No“.
Unvergleichlich sind für mich auch westfälische Kartoffeln vom Sandboden, die wir in meinen Kinderjahren noch handverlesen von meiner bäuerlichen Verwandtschaft mütterlicherseits bekamen und die im Keller in einer Kartoffelstiege lagerten. Meine Mutter zaubert bis heute die besten goldgelben Bratkartoffeln. Und das auf die denkbar einfachste Art und Weise: Fein gestiftelt in der Pfanne mit Öl und etwas Salz. Speck ist verpönt, weil der ja den guten Kartoffelgeschmack völlig überlagert. Aber auch schlichte Salzkartoffeln waren in meinen Kinderjahren mindestens vier Mal wöchentlich auf dem Tisch, weil jeder sie mochte und immer genügend da waren.
M: Milchsuppe mit Rosinen?!? Das wär jetzt so gar nicht meins, weil ich weder Milch (außer im Kaffee) noch Rosinen mag, die sind mir zu glitschig. Überhaupt esse ich am liebsten Sachen, die ich richtig kauen muss, die meinen Zähnen Widerstand bieten, Nüsse zum Beispiel oder Äpfel oder Brot mit harter Rinde. Deswegen bin ich generell kein begeisterter Suppenesser. Eintöpfe sind okay, stehen aber auch nicht an erster Stelle auf der Hitliste der Lieblingsgerichte. Und noch eins unterscheidet deine Familie von meiner: Bei uns waren Salzkartoffeln eine zwar häufige, aber nicht sonderlich geschätzte Beilage. Als ich ausgezogen war aus meinem Elternhaus und anfing, selber zu kochen, hab ich sie nie mehr zubereitet, lieber Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Gratin, Reiberdatschi, Rösti oder eben Fingernudeln. Eine Nachfrage bei meinen Geschwistern ergab: Bei ihnen kommen Salzkartoffeln auch eher selten bis nie auf den Tisch.
Ich habe übrigens im Lauf der Zeit mein eigenes Trostessen entwickelt: An Abenden, an denen ich nicht so richtig Lust aufs Kochen habe und auch nicht so gute Laune, mache ich mir Spaghetti, vermische sie mit einem Ei, Knoblauch, Petersilie und Parmesan und brate sie in Olivenöl richtig kross an, so dass ich sie schneiden muss. Und schon geht’s mir wieder besser.
Ich könnte mein Trostessen jeden zweiten Tag machen, und ich tu das auch manchmal, seit die Kinder aus dem Haus sind und ich keine Rücksicht mehr nehmen muss auf ihre Vorlieben oder Abneigungen.
A: Ich könnte mehrmals in der Woche Risotto essen – in allen nur möglichen vegetarischen Varianten mit Gemüse und Schwammerl oder ganz schlicht nur mit Safran (und natürlich einem Schuss Wein, Parmesan, einem Klecks Butter und frischer Petersilie oder Basilikum on top). Morgens esse ich – ganz im Sinne des Ayurveda – gern warm: Porridge oder schlicht Haferbrei mit wärmenden Gewürzen wie Zimt, Kurkuma, Vanille und einem Röster oder Obst – und das, obwohl ich diese Hafer-Milchsuppe meiner Eltern immer gehasst habe…
Genauso wie viele Fleischgerichte, vor allem Innereien und westfälisches Möpkenbrot! Letzteres war in der Pfanne gebraten vom Geschmack her gar nicht so übel – zumindest so lange, wie ich es als Kind für eine Art rund geformtes Getreide mit irgendwas drin gehalten habe. Als ich aber erfuhr, dass außer des Roggenschrots vor allem Speck, Schweineschwarte und Schweineblut für diese – mit Piment, Muskat, Majoran, Nelken und Pfeffer gewürzte – Kochwurst mit Getreide verwendet wird, hab ich es nie wieder angerührt. Die Gewürze darin liebe ich aber noch immer – wie fast alle Gewürze und frischen Kräuter.
M: Das Möpkenbrot klingt in der Tat etwas gruselig. Ich habe mir im Internet ein Foto davon angeschaut, es hat mich nicht verführt, es mal zu probieren, obwohl ich ja eigentlich vieles esse, was andere Menschen verabscheuen. Ich mag – bis auf Hirn – zum Beispiel Innereien sehr gerne und habe in Vor-Corona-Zeiten oft auf dem Viktualienmarkt Saures Lüngerl mit Semmelknödel gegessen, zum Unverständnis meiner Kinder. Die fanden und finden auch Labskaus schrecklich, die ich ebenfalls mag; sie nennen das Gericht fälschlicherweise „Moppelkotze“, in der Hoffnung, mir den Appetit darauf zu verderben, was ihnen aber nicht gelingt.
Moppelkotze gibt es übrigens wirklich, es ist ein dem (der?) Labskaus recht ähnlicher Eintopf aus Norddeutschland; gegessen habe ich ihn aber noch nicht, ausschließlich mangels Gelegenheit. Vermutlich würde er mir schmecken, trotz des Namens.
Apropos: In der DDR gab es ein Gericht namens „Tote Oma“, das hat mir eine Bekannte aus Thüringen erzählt, mit Blutwurst, Speck und Zwiebeln. Sie hat mir die Zubereitung geschildert, es klang eigentlich ganz appetitlich. Den Namen finde ich allerdings schon ein bisschen grenzwertig.
A: „Tote Oma“ ist so ungehörig, dass es fast schon wieder lustig ist. Und Moppelkotze sieht ja leider auch so aus wie der hintere Teil vom Wort. Die kann man auch nicht wirklich aufhübschen mit ein bisschen Kräuterdeko. Da wär mir im Zweifelsfall der westfälische Pfefferpotthast lieber, den meine Eltern – so lange wie ich denken kann – traditionell im Spätherbst in der Gaststätte Neuhaus im großen Saal im Rudel essen. Wenn ich da mal mitkommen sollte, werde ich mich wohl auf die sauren Essiggurken und die Rote Beete, die – ähnlich wie beim Labskaus – als Beilage serviert werden, konzentrieren. Und das Pils würde ich natürlich auch trinken!
Bei all den herzhaften und fleischlastigen Sachen, über die wir so schreiben, poppt bei mir grad in gelb-goldenem Glanz der Apfelpfannekuchen auf. DEN habe ich als Kind geliebt. Saure Äpfel – gern Boskoop oder die aus dem Garten – und obendrüber dann weißer! Zucker aus dem Zwiebelmuster-Keramiktopf. Lecker!
Und genauso gut wie die ersten bayerischen Rohrnudeln, die der Mann mal gemacht hat. Leider ist der gusseiserne Topf meiner Schwiegermutter nicht mehr da. Da sind die Rohrnudeln nämlich unten immer ordentlich obrennt und dieses – sagen wir mal – Karamellisierte muss wohl das Beste gewesen sein. Überhaupt waren bei der Münchner Mutter ja einige leicht angebrannte Gerichte sehr beliebt, fällt mir grad auf. Auch das Sauerkraut musste mindestens dunkelbraun angeschwitzt werden, ebenso wie die Rohrnudeln und natürlich die Fingernudeln. Verführerische Röststoffe, sag ich da nur! Die wirklich leckeren Sachen sind halt auch nicht immer unbedingt nur gesund. Und vielleicht stehen sie gerade deshalb ähnlich hoch im Kurs wie die verbotenen…
M: Ich überlege gerade, ob sich unsere Mütter schon viele Gedanken über gesunde Ernährung gemacht haben. Meiner war zum Beispiel wichtig, dass wir viel Obst aßen, der große Korb in unserem Esszimmer war immer gut gefüllt, vor allem mit Früchten aus unserem Garten, wie Äpfel, Birnen, Zwetschgen; im Sommer gab es auch viele Beeren von unseren Sträuchern.
Gemüse aßen wir natürlich auch viel – der Garten! – , allerdings kochte meine Mutter es immer viel zu lange, es war also nicht mehr, so wie wir es heute mögen, knackig, sondern schon etwas matschig und, wie ich annehme, deshalb auch recht vitaminarm. War es deshalb bei uns Kindern nicht sonderlich beliebt?
Süßigkeiten gab es in meiner Kindheit nicht sehr oft, ich vermute mal, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil es damals noch etwas wirklich Besonderes, Luxuriöses und auch Teures war. Wenn mal eine Tafel Schokolade auftauchte, mussten wir die natürlich teilen, dann blieb für jedes Kind höchstens eine Rippe. Was auch gar nicht üblich war, waren Snacks zwischen den Mahlzeiten; wenn wir mal jammerten, dass wir Hunger hätten, bekamen wir meist die kühle Antwort, „dann hättest du heute Mittag anständig essen sollen. Nimm dir einen Apfel.“ Und zu trinken bekamen wir Wasser und Früchtetee; Cola und Limo waren nur an Geburtstagen oder sonstigen Festen erlaubt und im Urlaub, da durften wir sie uns im Restaurant bestellen. Das war dann immer ein ganz besonderes Fest. Ich hab das übrigens mit meinen Kindern genauso gemacht, sie haben Unmengen von Wasser getrunken und tun es auch heute noch. Ihre Zahnärztin hat mich immer sehr dafür gelobt.
A: In meinem Elternhaus ist die Sache mit dem gesunden Essen unkompliziert. Obst, Gemüse und mehr gibt es meist nach Saison, im Herbst reichlich Äpfel und Zwetschgen (Garten!) im Winter dann orange-leuchtende Mandarinen, kernige Nüsse und Grünkohl, im Frühling Erdbeeren, Rhabarber und Spargel und im Sommer dunkelrote Kirschen und was sonst noch alles so reif ist. Exotisches wie Ananas oder Mango kennen sie zwar, aber Regionales ist ihnen einfach näher. Statt Matcha gibt es schwarzen Tee, statt Goji-Beeren schwarze Johannisbeeren und statt Weizengras halt Brokkoli. So einfach.
Und die beste Schokolade kaufte meine Mutter in einem kleinen Laden ihrer Freundin in der Stadt: Bruchschokolade mit Nüssen und Rosinen. Für mich gab und gibt es keine bessere, auch wenn ich mich im Bioladen immer wieder zu hübsch verpackten und verführerisch klingenden Varianten wie „Noir Chili“ oder „Love Chock“ hinreißen lasse. Vielleicht verdankt besagte Bruchschokolade ihren unangefochtenen Platz 1 aber auch dem rosig-verklärten Rückblick in unbeschwerte Kinderzeiten.
Übrigens: Wenn die Söhne in einigen Jahren einen Blog-Beitrag zu unserem Thema schreiben würden, hieße der mit großer Wahrscheinlichkeit: „Wie bei Vattern“, weil sie seit Kindertagen mit Leidenschaft in seinen Töpfen und Pfannen rühren. Ehrlich gesagt schmeckt es ihnen bei ihm auch meist besser als bei mir. Meine drängende ayurvedische Phase hat sie nie wirklich überzeugt und meine vegetarische schon gar nicht. In diese Memoiren werde ich also nicht eingehen, es sei denn, der Beitrag würde ausgeweitet auf Nachspeisen und Kuchen. Das kann ja dann bei uns ein ganz eigener Beitrag werden!