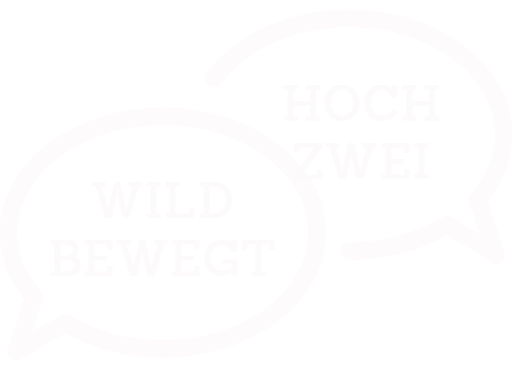A: Sowohl in meiner Yoga- als auch in meiner Ayurveda-Ausbildung habe ich gelernt, dass gewisse Routinen meinem Tagesablauf guttun. Anfangs hab ich mich bockig dagegen gesträubt, weil ich allein die Vorstellung, jeden Tag das Gleiche tun zu müssen, gähnend langweilig fand. Mehr noch, als freiheitsliebender Mensch fürchtete ich sogar um meine viel beschworene Unabhängigkeit. In der Pandemie, die uns seit mehr als einem Jahr in Atem hält, bin ich aber unglaublich froh, dass eine Art von Rahmen seit vielen Jahren meinem Tag Struktur gibt.
Wenigstens 15 Minuten verbringe ich morgens auf meiner Yogamatte – im Sitzen, Stehen, Liegen oder auf dem Kopf. Vorher hab ich Sesamöl in meinem Mund hin- und herbewegt, die Zunge gereinigt, die Zähne geputzt und mein Gesicht gewaschen. Und über all die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich keine Sekunde nachgedacht und das ist mindestens genauso gut wie die Tätigkeit an sich. Das einfache Tun und eben nicht Abwägen, zur Diskussion stellen, Vergleichen, Hinterfragen, gut oder schlecht, überflüssig oder wertvoll Finden löst bei mir mittlerweile eine entspannte Erleichterung aus, nicht alles im Leben in Frage stellen zu müssen.
Und trotzdem möchte ich nicht, dass das überhandnimmt, dass mein Tag zu vollgestopft ist mit dieser „Daily Routine“, wie sie mittlerweile im hippen Community-Jargon heißt.
Ganz anders, weil feierlicher, ist das mit einem Ritual, das ich vor vielen Jahren auf einem Überführungstörn eines Segelbootes von Triest nach Marmaris von unserem ganz wunderbaren, aber leider schon verstorbenen zweiten Skipper übernommen habe: Eine echte! Kerze in einer Kirche anzuzünden.
M: Das mit dem Kerzenanzünden in Kirchen mache ich auch schon lange, seit einem längeren Italien-Aufenthalt Ende der 70-er Jahre, da hab ich mir das von meiner halb-italienischen Freundin abgeguckt. Ich hab’s ja eigentlich nicht so mit Kirchen, aber ab und zu schlendere ich, vor allem auf Reisen, gerne kurz durch, lasse die Atmosphäre auf mich wirken und zünde meist nicht nur eine, sondern gleich mehrere Kerzen an, in Gedanken bei all den Menschen, die mir wichtig sind und deren Schutz ich mir wünsche. Aberglaube, ich weiß. Aber in dem Fall ist es mir egal.
Ich habe, wie vermutlich jeder Mensch, auch ein Morgen-Ritual, das sich allerdings von deinem unterscheidet – ich könnte es beispielsweise nicht über mich bringen, Sesamöl in den Mund zu nehmen. Ein bisschen Gymnastik mach ich auch, jedenfalls meistens. Das wichtigste aber ist der Becher Kaffee, den ich trinke, während ich auf meinem Balkon in den Himmel schaue, um die Wetterlage zu checken; danach folgt die „Süddeutsche“, ohne deren Lektüre der Tag nicht komplett ist. Wenn meine Tochter so gegen acht vorbeikommt, folgt ein weiteres wichtiges Ritual: Das gemeinsame Lösen des Kreuzworträtsels! Sie fängt an, ich steige ein, wenn sie nicht mehr weiterkommt, wobei ich bei Fragen wie der Währung von Namibia oder einem Fluss in Graubünden auch passen muss.
Wir haben bei diesem Ritual den Ehrgeiz entwickelt, so wenig wie möglich googeln zu müssen; ganz ohne ging es leider bisher nicht ab. Aber wenn am Ende nur ein paar Kästchen freibleiben, sind wir schon sehr stolz.
Ich finde solche kleinen Rituale schön und auch wichtig, allerdings muss man aufpassen, dass man trotzdem offen und flexibel bleibt und nicht in der Routine erstarrt. Ich kannte mal eine ältere Dame, die jedwede Abweichung davon ablehnte, sie ging jeden, aber auch wirklich jeden Tag um Punkt 9 zum Einkaufen auf den Markt, aß um Schlag halb eins zu Mittag, besuchte das Grab ihres Mannes auf dem Friedhof um genau 15 Uhr… Sie brauchte das offenbar, um ihrem Leben eine Struktur zu geben, war aber gleichzeitig in ein doch sehr enges Korsett eingeschnürt. So sollen meine Rituale nicht sein.
A: Meine auch nicht, weil sie dann schon etwas Zwingendes haben, was es im normalen Alltag ja nun wirklich schon ausreichend gibt. Meine große Leidenschaft, in Kirchen eine Kerze anzuzünden, ist eng verknüpft mit dem einen Menschen, von dem ich diese Tradition übernommen habe. Der wunderbare H. Heine (wie der Dichter, jaja!) sprang in jedem Hafen, in den wir auf dem erwähnten dreiwöchigen Segeltörn einliefen, als Erster auf die Pier und ließ sich mit mir intuitiv zur nächstgelegenen Kirche treiben, die er meist auf direktem Wege fand. Manchmal waren wir vorher tagelang auf See gewesen und der Boden unter uns schwankte noch mächtig, wenn wir uns durch die engen Gassen der zuweilen kleinsten griechischen Inseln schlängelten.
H.H. war sehr gläubig und trank keinen Tropfen Alkohol im Gegensatz zu allen anderen Männern an Bord, die sich von Einlaufbier zu Auslaufbier hangelten und abends nach rauer See und halsbrecherischen Manövern auch gern mal selbstgebrannten Slivovitz die Kehle runterspülten. H.H. rauchte dafür wie ein Schlot und zitierte Heine und Rilke, wenn wir beide nachts zusammen Wache hatten und er am Ruder stand. Er tat das ohne Pathos, aber voller Inbrunst und lachte danach oft so kindlich vergnügt, dass mir immer ganz warm ums Herz wurde.
Das Entzünden der Kerze war dagegen ein Zelebrieren in heiliger Stille. Wenn aber die schwere Kirchentür hinter uns ins Schloss fiel, steckte er sich gleich eine an und hatte sofort dieses Verschmitzte, fast Rotzlöffelige, das ihn über sein einziges Laster, das Kettenrauchen, milde hinwegsehen ließ. All das zusammen steigt bei mir in einem wohligen Gefühl auf, wenn ich in einer Kirche eine Kerze anzünde. Und wenn es diese schmalen, langen Kerzen sind, die man in ein Sandbecken stecken kann, ist das Gefühl, begleitet vom Geruch nach Myron und Tabakrauch, noch präsenter, weil es mich direkt in eine dieser kleinen griechisch-orthodoxen Kirchen beamt, in denen ich vor vielen Jahren mit H. Heine stand.
M: Schön, wenn Rituale so verknüpft sind mit bestimmten Personen und Erinnerungen an sie.
Kindern sind Rituale ja sehr wichtig. Mit meinem Sohn hatte ich zum Beispiel die Angewohnheit, ihm abends erst vorzulesen und danach aus dem bereits erwähnten Liederbuch von Tomi Ungerer vorzusingen. Es gab Abende, da war ich eigentlich viel zu müde und hätte gerne mal drauf verzichtet, aber er hat es immer gnadenlos eingefordert, ohne Lesen und Singen war der Tag nicht komplett und beendet.
Ich glaube auch nicht, dass ich noch einen Weihnachtsbaum hätte ohne meine Kinder. Vor ein paar Jahren habe ich mal vorsichtig den Vorschlag gemacht, das ganze Brimborium sein zu lassen, sie waren immerhin beide schon über 20. Sie schauten mich ganz entgeistert an und lehnten die Idee rundweg ab: Ein Weihnachtsbaum muss sein! Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wohingegen ihnen erstaunlicherweise Geschenke schon lange nicht mehr so wichtig sind.
Das jährliche Ritual sieht also so aus, dass mein Sohn am 23.12. loszieht und die Tanne (was anderes kommt nicht infrage!) besorgt und in meine Wohnung schleppt. Geschmückt wird der Baum dann gemeinsam, unter Austausch vieler Erinnerungen, z.B. an die von meiner Mutter handbemalten Glaskugeln oder an die Basteleien aus dem Kindergarten, die wundersamerweise die vielen Jahre überlebt haben und natürlich auch am Baum hängen müssen.
Auch das Weihnachtsessen ist selbstverständlich ein Ritual: Wo es bei vielen anderen Leuten an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat gibt, kommt bei uns Crispy Duck auf den Tisch, also gebratenes Entenfleisch, das mit Frühlingszwiebeln und einer speziellen Soße in Lotosblätter-Pfannkuchen eingewickelt wird; das Ganze isst man aus der Hand. Ein von allen sehr geliebter Brauch – auch von mir, der Köchin, die damit vergleichsweise wenig Arbeit hat!
A: Ich war am Wochenende glückliche Teilnehmende eines Rituals, das es seit mehr als 30 Jahren in meinem Leben gibt. An einem Juni-Sommerwochenende treffe ich mich alljährlich mit alten westfälischen Schulfreunden zum Lachen, Volleyballspielen, Grillen, Ratschen und zum Königsschießen. Nach alter Tradition wird unter den Jungs, die natürlich schon längst Männer sind, der Fußballkönig in einer Art Elfmeterschießen ausgespielt. Der Sieger bekommt den Pokal, der schon mehrfach geklebt wurde, weil er immer am schmalen Bein des in Gips gegossenen Fußballjungen in Sporthose bricht, der einen Ball vorm rechten Fuß hat. Der Sockel unter dem Kicker musste schon mehrmals durch einen zweiten und dritten Sockel aufgestockt werden, weil sonst kein Name zur Gravur mehr draufpasst. Und ein neuer und dazu womöglich noch glänzender Kelch-Pokal wäre so was wie ein gotteslästerlicher Frevel. Der Wanderpokal war nur ein einziges Mal nicht zur Krönung des neuen Königsschützen vor Ort, weil mein Bruder ihn nach einem Umzug von Berlin nach München nicht finden konnte. Da war was los, sag ich dir!
Begonnen hat das Ganze noch zu Schulzeiten mit einer Anmeldung zu einem Volleyballturnier im holländischen Maashees, wo wir als „Mixed Ungeübt“-Mannschaft antraten und „Schimmliges Brot“ hießen, weil wir nach einer langen durchfeierten Nacht morgens in glühender Hitze in unseren Zelten aufwachten und schimmliges Toastbrot zum Frühstück vorfanden, das wir kurzerhand mit auf das Volleyballfeld nahmen und hinten bei der Angabe-Linie postierten, damit der Ball dort vor dem Aufschlag symbolisch eingetaucht werden konnte. Das war wohl eine Art beschwörendes Ritual und sollte so was wie Glück im Spiel bringen. Ich weiß nicht mehr, ob wir das Turnier gewonnen haben. Wenn, dann aber vor allem deshalb, weil die Gegner irgendwann völlig entnervt waren von uns Spielern aus Deutschland, die sich ständig vor Lachen krümmten und trotzdem noch irgendwie den Ball übers Netz bekamen.
Von diesen alljährlichen Turnieren kamen wir immer völlig übernächtigt, sonnenverbrannt und mit Schmerzen im Zwerchfell (und auch sonst überall) nach Hause, weil wir ein langes und schmutziges Wochenende vor allem eins gemacht hatten: Gelacht.
Das ist heute immer noch so, auch wenn wir mittlerweile unsere eigenen Mini-Volleyballturniere untereinander spielen und uns seit vielen Jahren in irgendeiner uncharmanten, aber ungemein praktischen deutschen Mehrzweck-Jugendherberge treffen. Wenn dann einer nach dem anderen eintrudelt, amüsieren sich die schon Anwesenden über den immer gleichen Enten-Gang des Ankommenden, das sich niemals verändernde Breitmaulfrosch-Grinsen oder die kurzen Beine unseres Sitzriesen, die auch nicht mehr länger werden. Und das Merkwürdige ist: Das wird niemals langweilig!
M: Das klingt nach sehr viel Spaß und guter Laune – ein wunderbares Ritual! Das Foto, das du mir geschickt hast, transportiert die Stimmung auch sehr gut!
Übrigens haben nicht nur Menschen Rituale: Unser Hund pflegt sie auch! Wenn er abends sein Trockenfutter bekommt, beginnt er nicht gleich zu fressen, sondern pickt die ersten zwei Pellets (und nur die!) aus dem Napf heraus und legt sie säuberlich daneben ab (warum, weiß der Geier!). Erst wenn er die ausreichend beschnüffelt und dann einzeln vertilgt hat, macht er sich über den Rest des Futters her. Seine zweite Eigenart: Nach dem Feuchtfutter am Morgen läuft er ins Wohnzimmer und putzt sich den Mund am Teppich ab! Mir missfällt das etwas, weil ich denke, er könnte sich das Maul auch abschlecken, aber er lässt sich nicht davon abbringen. Und ich muss den Teppich halt öfter saubermachen, auch nicht so schlimm.
Essensrituale sind natürlich auch bei Menschen weit verbreitet und sorgen bisweilen für Irritationen oder sogar Missbilligung. Ich hatte mal einen Kollegen, der nach jedem Bissen sein Besteck weglegte, sich den Mund abwischte (allerdings nicht am Teppich!) und einen Schluck aus seinem Wasserglas nahm, bevor er weiteraß; die Nahrungsaufnahme dauerte dadurch deutlich länger als bei anderen. Ich fand das zunächst eigentlich ganz lustig, konnte aber mit der Zeit auch verstehen, dass es einige der anderen am Tisch störte und nervte und sie seine Gesellschaft beim Mittagessen mieden.
Für eine andere Kollegin mussten die einzelnen Bestandteile der Mahlzeit auf ihrem Teller genauestens arrangiert werden: Das Fleisch kam nach links unten, die kohlehydrathaltigen Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln etc. nach rechts. Oben auf den Teller kam dann das Gemüse. Da wir in einer Kantine aßen und der Essensverteiler auf ihre Eigenheit keine Rücksicht nehmen wollte, brauchte sie einen zweiten, leeren Teller, auf den das Gericht dann vorschriftsmäßig drapiert wurde. Auch diese Obsession wurde bestensfalls belächelt, meist aber mit hochgezogenen Augenbrauen beobachtet, was die Kollegin aber nicht störte; anders wollte sie einfach nicht essen. Wobei ich mich da schon frage, ob das noch ein Ritual ist oder schon ein Spleen oder Tick…
A: Die Übergänge vom Ritual zum Spleen sind vermutlich fließend und diese megapingeligen Abgrenzungen auf Tellern, Schreibtischen und in Kleiderschränken auch schon mal manisch und im besten Falle lustig. In unserer Familie gibt es zwei Gruppen: Die, die alles auf einem Teller zusammenmatschen und die, die für alles eine extra Schüssel brauchen. Bemerkenswerterweise geraten die Separierer und die Zusammen-Matscher auch in Diskussionen (vor allem politisch!) öfter mal aneinander und sind in ihren Standpunkten höchst unvereinbar. Jeder von uns schleppt halt auch Gepäck in Form von Mustern, Angelerntem, abgrundtief Verhasstem und euphorisch Geliebtem mit sich rum.
Meine bayerische Schwiegermama ließ zum Abschluss der Osternacht immer die bunt bemalten Eier ihrer Kinder und das selbst gebackene Osterbrot segnen. Meist waren ihre Eier die schönsten und künstlerisch wertvollsten (auch wenn das ja letzten Endes subjektiv ist – außer in Bayern…) und fanden große Anerkennung bei den Mitkirchgängern. Da sie ein großes Herz hatte, verschenkte sie einige der Eier bei auffälligem Dauerlob oder gab sie im Tausch für ein weniger schönbemaltes her. Sohn und vor allem Tochter (Letztere war wohl die Künstlerin im Haus) fanden das natürlich ungerecht, wenn Muttern die fremden hässlichen, aber immerhin frisch gesegneten Eier beim großen Osterfrühstück auf dem Tisch präsentierte. Gutes Werk hin oder her!
Für mich hat sich ein Ritual meines Vaters tief in meinen Biorhythmus eingegraben. Im Hauptberuf Lehrer, pflegte er kompromisslos das Ritual der berühmten Mittagsruhe. Nach Schule und gemeinsamem Essen legte mein Vater sich für ein Viertelstündchen aufs Ohr, „ne Naune“ machen, wie er zu sagen pflegte. Meist konnte man schon kurz nachdem er die Beine aufs Sofa gelegt hatte, ein lautes Schnarchen oder leises Säuseln hören, er brauchte keine halbe Minute zum Einschlafen… Aber wehe, es rief einer an in dieser heiligen Zeit! Das waren dann die Ruhestörer, die IMMER zur Mittagszeit anriefen! Und dann gab es natürlich noch die, die eisern und perfekt erzogen bis eine Minute nach 15.00 Uhr warteten. Das waren die Guten!
Ich hab manchmal heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich dringend jemanden zwischen 14.00 und 15.00 Uhr anrufen muss. Und ich vermeide es bis auf den heutigen Tag, in dieser hochheiligen Ruhe in meinem Elternhaus anzurufen. Aus heutiger Sicht finde ich das Ritual, das mein Vater da geschaffen hat, sogar recht wertvoll, weil er sich eine Lücke in seinem turbulenten Alltag geschaffen hat. DAS muss man sich ja heutzutage hart erarbeiten…
M: Die Zeit zwischen Mittag und 15 Uhr war auch bei uns daheim sakrosankt, da machten meine beiden Eltern auch ihre Mittagsruhe, mein Vater mit dem „Spiegel“ (und meistens etwas Schokolade), meine Mutter ohne Einschlafhilfe, da sie den ganzen Tag auf den Beinen war und sehr schnell in einen kurzen Schlaf fiel. Auch bei uns war es komplett verpönt, in diesen Stunden anzurufen, es galt einfach als schlechte Erziehung. In meiner Kindheit konnte man gegen solche Ruhestörer auch nichts unternehmen, außer das Telefonkabel aus der Wanddose zu ziehen, was natürlich nicht geschah; so was wie eine verstellbare Lautstärke der Telefonklingel gab es damals noch nicht.
Ein zweites Ritual war ebenso wichtig: Die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr, da wurde eisern die Tagesschau geguckt und zwar von der GANZEN Familie; wer in dieser Zeit anrief, outete sich als politisch ignorant. Während dieser heiligen 15 Minuten wurde übrigens heftig über das Weltgeschehen diskutiert, zwar in gedämpfter Lautstärke, dennoch aber störend für die, die jedes Wort der Nachrichten verstehen wollten und die Debattierenden anzischten. Und wenn dann mittendrin das Telefon schrillte, ging ein genervtes Aufseufzen durch die Versammelung. Auf die Idee, es einfach mal klingeln zu lassen, kam allerdings niemand. Ich mache das heute ganz anders: Wenn ich keine Lust zum Telefonieren habe, gehe ich einfach nicht ran; dank der Rufnummererkennung an Festnetzapparat und Handy weiß ich ja auch immer gleich, wer dran ist, und ob ich mich auf ein längeres Telefonat einstellen muss.
In meiner Kindheit, aber vor allem Jugend war Telefonieren ein großes Problem: Unser Apparat stand im Flur auf einem Tischchen neben einem Sessel, der sich bei ausgiebigen Gesprächen als sehr nützlich erwies. Der Standort bedeutete allerdings, das man selten schnell genug am Telefon war, um lang erwartete Anrufe entgegenzunehmen; irgendeiner riss immer vor mir den Hörer von der Gabel (ja, sowas gab’s noch) und brüllte dann durchs ganze Haus „Martina, Telefon, irgendein Typ!“ Ich versuchte dann immer, mit dem Telefon ins angrenzende Wohnzimmer zu gehen, aber erstens war die Schnur (IMMER total verheddert) kaum lang genug, um die Tür hinter sich schließen zu können, und zweitens war auch in diesem Raum ständig irgendjemand, der keinerlei Anstalten machte, sich diskret zurückzuziehen. Ich hockte also genervt im Flur und alle, die vorbeigingen – und das waren in solchen Momenten überraschend viele – taten ganz geschäftig und desinteressiert an meiner Unterhaltung, kriegten aber natürlich jedes Wort mit. Nach Ende des Telefonats folgte die Inquisition: Wer war das? Wieso nennt der seinen Namen nicht am Telefon (sehr unhöflich!). Woher kennst du den? Wie alt ist der? Was machen seine Eltern? Und, das Wichtigste: Willst du dich mit dem treffen, und falls ja, wann und wo? Ich hab das GEHASST!
A: Haha! Das kommt mir sehr bekannt vor. Unser Schnurtelefon stand in der Diele direkt neben dem Esstisch. Ausweichen konnte man nur in die Küche, in der auch immer irgendjemand rumlungerte. Auf besagtem Telefonapparat rief nach den langen Sommerferien Michel aus Bourdeaux ein paar Mal in der Mittagzeit an, als die ganze Familie am Tisch versammelt war. Nach einem ersten Tête-à-Tête im Spanienurlaub, in dem ich ihn kennenlernte, hatte sich zwischen uns eine zarte Romanze entwickelt. Und obwohl ich fast kein Wort Französisch sprach (weil ich Depp Latein gewählt hatte!) und er als Franzose natürlich kein Wort Deutsch, verstanden wir uns blind – was wohl in erster Linie der intensiven Sprache unserer Körper geschuldet war…
Unter den kritischen Augen meines fließend Französisch sprechenden Bruders (der schlauer war und kein Latein gewählt hatte!) und – ob meines nervösen Stammelns – naserümpfenden Vaters, habe ich mit Michel drei solcher Telefonate überstanden, die unsere von schmerzlicher Sehnsucht geprägte Fern-Liaison leider glanzlos beendete.
Ich bin mir aber ganz sicher – hätten wir nicht dieses lauernde und hämische Publikum gehabt – wären unsere Telefonate sicher zu einem herzzerreißenden Ritual mit immer den gleichen drei oder vier gesprochenen schmachtenden Worten geworden. Und die klingen ja selbst im schlechtesten Französischen verführerisch. Dazwischen dann vielleicht noch ein verzehrendes Seufzen oder tieftrauriges Schniefen.
Erstaunlicherweise ist diese Vorstellung grad so präsent in mir, dass sie sich – in Wiederholungsschleife – immer wieder neu in meinem Kopf abspielt. Ein Ritual muss also gar nicht real sein, damit man es zelebrieren kann. Allein die Fokussierung der Gedanken bringt mich in diesen gleichmäßig pulsierenden Modus des Irgendwie-Verliebtseins-An-Sich. Und diese unvollendeten Phantasie-Lieben werden ja auch nie langweilig, weil sie sich nicht der schnöden Realität stellen müssen. Das haben sie mit den Ritualen dann wohl gemeinsam: Mit denen wird einem ja auch nicht fad, sonst würde man sie wohl nicht immer und immer wiederholen...