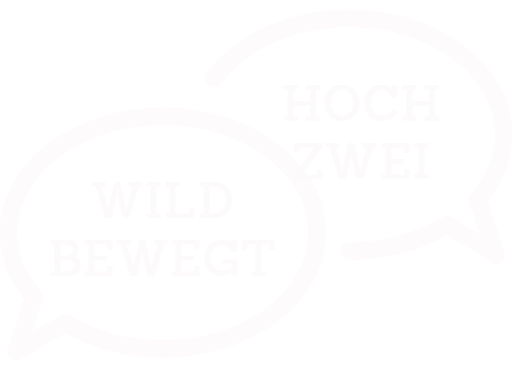A: Letzte Woche war ich mit einer Freundin auf der Kotalm (heißt echt so!) bei Fischbachau. Ich liebe es, frühmorgens staufrei durch München zu fahren und schon nach wenigen Kilometern auf der Autobahn die Berge am Horizont zu entdecken. Und jedes Mal ist es so, als sähe ich sie zum ersten Mal. Da setzt einfach kein Gewohnheitseffekt ein, keine Langeweile! Im Gegenteil: Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, erstaunt und atme – schon fein konditioniert – automatisch tief ein und gaaaanz lang aus.
Der Aufstieg war – wie immer – steiler und beschwerlicher als gedacht. Auf der halben Strecke wurde es kalt und windig, wir schnatterten, setzten aber unermüdlich einen Fuß vor den anderen. Es gibt nur eine Richtung – bergauf – und das beruhigt mich immer ungemein. Die Rhabarberschorle auf der Kesselalm schmeckte so gut wie keine andere davor, auch wenn der eisige Wind um die Hütte fegte und wir uns die Kapuzen tief ins Gesicht ziehen mussten. Die letzten Meter zur Kotalm waren ein Kinderspiel, weil das Ziel direkt vor unseren Augen lag. Und dann saß da der Toni auf seiner selbst gezimmerten Holzbank und hatte grad einen Filterkaffee mit der Hand aufgegossen.
Am Tag nach diesen Wanderungen sind meine Beine schwer, ich hab Muskelkater in den Pobacken und den Wadeln und finde es…großartig! Was für ein Schwachsinn eigentlich: Ich quäle mich früh aus dem Bett, dann den Berg hoch und wieder runter, friere wie ein Schneider, trinke ausgesprochen Gewöhnliches, esse Kuchen aus der Tupperdose und hab am nächsten Tag fiese Schmerzen beim Treppe runtergehen…
M: Auf deine Schmerzen kann ich gut verzichten, aber das befriedigende Gefühl nach stundenlanger Bewegung kann ich sehr gut nachvollziehen, ich kenn das auch. Auf irgendwelche Almen zu wandern ist allerdings nicht so meins; wie du weißt, bin ich ja gar kein Fan von Bergen und hole die Wanderstiefel höchstens mal aus dem Schrank, wenn meine Freundin R., die am Schliersee wohnt, mich zu einer Tour überredet. Ich laufe viel lieber in der Ebene, zum Beispiel an der Isar entlang oder im Englischen Garten nordwärts, das allerdings auch stundenlang. Mit meinem extrem lauffreudigen Sohn, der auch nach einem 10 – 12 Stunden dauernden Arbeitstag noch von Geiselgasteig bis nach Schwabing zu Fuß geht, was mindestens drei Stunden dauert, bin ich, vor allem während der Corona-Lockdowns, halbe Tage durch die Gegend gestromert, auch in der Stadt; ab und zu haben wir mit dem Hund auch Ausflüge ins Umland gemacht, vorzugsweise unter der Woche, meistens sind wir Strecken zwischen 10 und 20 Kilometern gelaufen, das war auch für das Tier sehr gut machbar.
Als Kind mochte ich unsere Familien-Wanderungen am Wochenende und in den Ferien sehr, als Jugendliche weniger, da hab ich mich dann schnell ausgeklinkt. Mein Vater war auch so ein fanatischer Läufer wie mein Sohn; alles unter fünf Kilometern war für ihn ein „Spaziergang“, eine richtige Wanderung fing erst so bei 10, 12 Kilometern an. Bei unseren Touren bediente er sich uralter Karten, die an den Knickfalten schon ganz brüchig waren; die Einkehrmöglichkeiten, die darauf verzeichnet waren, existierten in den meisten Fällen schon jahrzehntelang nicht mehr, was bei uns Kindern, die wir uns auf eine Limo in einem Gasthaus gefreut hatten, für großen Frust sorgte. Trotzdem erinnere ich mich gerne daran, auch an das wunderbare Gefühl abends im Bett, wenn der ganze Körper erschöpft und die Beine so richtig schön schwer waren…
A: Diese gestrigen Karten und Atlanten (Atlasse kommt mir nicht in die Tastatur!) hat mein Vater bis heute. Allerdings weniger zum Wandern, sondern mehr zum Radeln und vor allem Skilaufen. Wir fuhren oft zwei Mal im Jahr, davon 1x Mal in die Dolomiten. Mit scheußlich-bunten Skioveralls vom Ski-Basar mühten wir uns, im engem Vorarlberger Skistil (breitbeinig fahren war verpönt) in der Spur meines Vaters zu bleiben, der Skilehrer nicht nur für seine Kinder war, sondern auch für unsere Freunde, von denen immer welche dabei waren.
Im Lift wurde dann die uralte Karte der Sella Ronda aus dem Rucksack gezogen – die neueren Versionen waren in seinen Augen keinen Deut besser! – und die Route gecheckt. Eingezeichnete, antiquierte rote Pisten waren auf der aktuellen Tour dann plötzlich schwarze und die Skihütten wundersamerweise nicht mehr bewirtschaftet. Viel wichtiger als die Kräuterlimo oder das Bier meines Vaters war aber, die Uhrzeit der letzten Fahrt an den Liften zumindest so ungefähr zu kennen, weil wir zu den Letzten gehören wollten, die mit hechelnder Zunge noch mal hochfuhren, damit wir die Tal-Abfahrt ganz für uns hatten. Manchmal sahen wir von oben, dass der Lift schon stand und meine Sorge, im Schneesturm irgendwo in den Bergen übernachten zu müssen, gab mir den letzten Energieschub, mit meinen inzwischen Pudding-Beinen – jetzt eindeutig breitbeinig – über die finale Piste zu rutschen. Der Weg von der Talstation in Skischuhen zum Bus oder Auto war die Hölle. Fast so schlimm, wie der Moment, wenn meine Brüder und Freunde ihre Skischuhe im Zimmer auszogen.
Nach dem Duschen und Essen (endlich!) glühten unsere Wangen beim Karten kloppen und am nächsten Tag ging alles wieder von vorn los.
Mein Bewegungsdrang und die Liebe zu den Bergen wurden wohl in dieser Zeit manifestiert. Und der stundenlange disziplinierte Verzicht auf alles, was ich mir in solchen kräftezehrenden und ausgehungerten Momenten wünschte (Kaiserschmarrn! Germknödel! Buchteln! Gröstl! Kräuterlimo! Schlaf!), lässt mich den Germknödel viel besser in Erinnerung haben, als er vermutlich jemals war. Und jetzt frag ich mich grad, auf was sich dein Sohn nach dem Drei-Stunden-Marsch vom Münchner Süden in den Münchner Norden am meisten freut…
M: Ich habe ihn gefragt: Er sagt, worauf er sich während der drei Stunden am allermeisten freut, ist sein Bett! Seinen Appetit stillt er nämlich schon auf dem Weg – hier ein Döner, dort ein Stück Pizza oder eine Currywurst, dazu gegen Ende, wenn das Ziel nicht mehr weit entfernt ist, ein kaltes Weg-Bier. Dann zuhause Stiefel und Klamotten aus, eine Dusche und ab in die Kiste!
An das Skifahren erinnere ich mich auch noch sehr gut. Wir sind früher immer zu viert in die Schweiz gefahren, ins Wallis, in Sichtweite von Eiger, Mönch und Jungfrau, ein beeindruckender Anblick. Die Woche, die wir dort verbrachten, kostete ungefähr so viel wie ein ganzer Monat im Süden, denn die Eidgenossen nehmen, was sie kriegen können. So mussten wir in einer Ferienwohnung zum Beispiel für eine Ersatzrolle Klopapier 25 Rappen bezahlen, obwohl bei Ankunft nur noch ungefähr 3 Blatt auf der Rolle waren.
In unserem letzten Ski-Urlaub waren wir vom Pech verfolgt. Die ersten drei Tage regnete es, dann wurde es eisig kalt, die feuchten Pisten froren ein, neblig war es noch dazu. Was zur Folge hatte, dass der Sohn am ersten Tag, an dem wir wieder fahren konnten, mit seinem Snowboard auf einer Eisplatte stürzte und sich den Arm brach. Zwei Tage mit Schlechtwetter hielten wir noch aus, dann brachen wir den Urlaub kurzerhand ab und fuhren wieder heim. Und haben seither keinen mehr gemacht; irgendwie hatten wir alle das Gefühl, dass diese Zeit, die wir sonst schon immer sehr genossen hatten, unwiederbringlich vorbei sei. Ein kleines bisschen trauere ich diesen Ferien schon hinterher, wenn ich ehrlich bin, ich bin sehr gerne Ski gefahren. Aber ob es in 20 Jahren überhaupt noch ein Massensport sein wird? Am Schnee fehlt’s ja jetzt schon überall. Und ein wirklich gutes Gewissen hätte ich dabei auch nicht mehr. Dann doch lieber laufen! Oder schwimmen! Oder radfahren!
A: Mit dem Radl fahre ich jeden Tag zwischen 5 und 20 Kilometer – mal mehr, mal weniger, aber eben täglich. Ins Büro, ins Studio, zum Einkaufen, in den Biergarten, ins Kino, zum Essen, ins Museum. Und das bei Wind und Wetter, weil ich inzwischen gut ausgestattet bin mit Gummistiefeln, Regenjacke, Regenhose und fröhlichem Regencape.
In meiner Kindheit bin ich ähnlich viel mit dem Radl unterwegs gewesen, überhaupt war ich als Kind immer in Bewegung. Wir spielten direkt vor unserem Haus Völkerball, Rollschuhhockey und schlicht Fangen oder Verstecken, gingen auf Pingeljagd (da musste man fix sein!), tobten uns beim Gummitwist, Dosen- und Stelzenlaufen oder mit diesen quietschbunten Hula-Hoop-Reifen aus. Nebenbei trainierte ich drei Mal in der Woche im Turnverein und mein jüngerer Bruder spielte Volleyball, so dass unsere Wochenenden oft mit Fahrten zu irgendwelchen Wettkämpfen in ostwestfälischen Orten mit sehr merkwürdigen Namen belegt waren, die ich noch nie vorher gehört hatte. Den freien Samstag oder Sonntag in stickigen, schweißmuffeligen Turnhallen zu verbringen war völlig normal, danach ging es ja wieder an die frische Luft.
Ich sehe heute keine Mädchen mehr Gummitwist spielen und vielleicht liegt das auch daran, dass man sich dabei schrecklich in die Haare kriegen kann. Ich erinnere mich an Dialoge à la: „Berüüüührt!“ „Neee, gar nicht!“ „Woohhl!“ „Blöde Kuh!“ „Wer’s sagt isses selber!“
Meist brach dann eine meiner Mitspielerinnen in Tränen aus und ging petzen bei Mami und Papi. Die wären nicht im Leben darauf gekommen, sich einzumischen, wohl wissend, dass am nächsten Tag sowieso alles vergessen war – bis zum nächsten Streit. DAS und die Selbstverständlichkeit, sich zu bewegen, gibt es ja heute immer weniger. Ich werde spätestens nach zwei Stunden „Auf-Irgendeinen-Bildschirm-Glotzen“ unruhig und muss mich bewegen. Deshalb sitze ich auch immer auf meiner Yogamatte vorm Fernseher, da kann ich nebenher noch ein Bein heben oder – wenn es furchtbar langweilig wird – eine Kerze machen, die im heutigen Wording dann der Schulterstand wäre.
M: Gummitwist haben wir eine Zeitlang als Kinder auch fanatisch gespielt, in jeder freien Minute, auch in den Pausen auf dem Schulhof; ich könnte es heute noch, so sehr haben sich mir die einzelnen Bewegungsabläufe eingeprägt.
Danach war eine Weile Federball schwer angesagt, das spiele ich auch heute noch gerne; danach kam Tischtennis (dito), Hula Hoop, Rollschuhlaufen… Es stimmt schon, wir waren viel in Bewegung. Das Skifahren zum Beispiel haben wir auf einem kleinen Berg gelernt, an dem es natürlich noch keinen Lift gab. Wir mussten also entweder mit den Ski auf der Schulter aufsteigen oder mit den Brettern an den Füßen, was deutlich mühsamer war. War man oben angelangt, waren die Beine schon etwas schwer. Und die Abfahrt natürlich viel zu kurz für die Mühe zuvor.
Stelzen hatten wir auch, die wurden extra angefertigt, zu kaufen gab es sie, zumindest in unserer Gegend, nicht. Ich weiß noch, wieviel Spaß es mir machte, als ich den Bogen erst mal raus hatte. Die Kür dabei war, Treppenstufen rauf und runter laufen zu können, aber nicht einfach so, sondern nach dem Rhythmus eines Liedes. Ob ich das noch könnte? Ich hätte direkt Lust, es mal wieder auszuprobieren, aber läuft heute noch jemand auf Stelzen, außer den Clowns in den Fußgängerzonen?
Wir haben damals in unserem Dorf nicht nur in den Gärten und Höfen gespielt, sondern oft auch auf der Straße, es waren ja zu der Zeit kaum Autos unterwegs. Ich weiß nicht, ob das auf dem Land heute noch denkbar wäre; in der Stadt ganz sicher nicht. Die Kinder hier sind also auf Sport- und Spielplätze und Parks angewiesen; in den Höfen der Mietshäuser sind sie meist nicht erwünscht, wie ich den dort aufgestellten Schildern entnehme. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich auf meinen Streifzügen durch den Englischen Garten Fußball- und sonstige Teams sehe, die sich dort austoben, oft auch Erwachsene, die dann mit viel Leidenschaft und Geschrei wieder zu Kindern mutieren, Diskussionen und lautstarke Streitereien inklusive.
A: Ich habe heute nach langer, langer Zeit mal wieder kreischende Kinderstimmen gehört! Während einer Privatstunde lag mein Yogaschüler friedlich und erschöpft in Shavasana – also dieser Endentspannung – als vom Schulhof nebenan, bölkende, schreiende, juchzende Kinder zu hören waren, die die Pause offenbar schamlos ausnutzten, um ihre Lungenkapazität und ihr Stimmvolumen zu testen. Ich fands großartig und hätte am liebsten laut mitgebrüllt, so befreiend klang das. Und mehr noch: Ich konnte förmlich spüren, wie sie ihre Lungen aufblähten, die Stimmbänder bis zum Anschlag vibrieren ließen und nebenbei ihr Selbst-Bewusstsein, Durchsetzungsvermögen und ihre Unbändigkeit spürten und ordentlich aufpolierten. Mein erster Impuls war, aus meiner braven meditativen Sitzhaltung aufzuspringen, mir auf die Brust zu trommeln (ich hätte es dann im Yogatalk Thymusdrüse genannt) und wie ein Affe mit schwingenden Armen diesen „Ook Ook Ook-Ruf“ lauthals zu brüllen. Das ist wohl onomatopoetisch der charakteristische Laut für Affen, hab ich grad mal nachgelesen. Was für ein Wort! Onomatopoesie! Da ist Lautmalerei doch ein bisschen zugänglicher und irgendwie näher dran am „Ook“.
Na jedenfalls hatte ich so was eine Ewigkeit nicht mehr gehört, weil ja ein Aus-der-Puste-kommen seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr salonfähig ist und die Menschen schon zusammenzucken, wenn ein Jogger an ihnen vorbeiläuft und über den Mund stoßweise die Luft rauspresst. Ich hab das Gefühl, das alles, was irgendwie körperlich anstrengend ist, ein großes Stück weit verpönt ist seit geraumer Zeit. Aber wie soll man denn Sport machen, ohne tief ein- und dann vollständig – mit Millionen von Aerosolpartikeln begleitet – auszuatmen? Die Atmung ist doch das, was uns ins Leben bringt und auch dort hält und dieses flache Atmen durch die Maske ist für mich eine der größten Freiheitseinschränkungen ever und damit eines der größten Opfer, die ich bringen muss…
Allein der Gedanke daran treibt mich wieder auf den nächsten Berggipfel, auf dem Atmen noch erlaubt ist. Und wenn am Gipfelkreuz grad Rushhour ist und ich auch hier anderthalb Meter Abstand halten muss, bau ich mir mein eigenes kleines Gipfelkreuz auf dem nächsten Hügel, auf dem ich mich dann laut schnaufend, jauchzend und erschöpft, aber glücklich, rücklings auf den Boden plumpsen lassen kann, um von da aus in den bergblauen Himmel zu schauen.